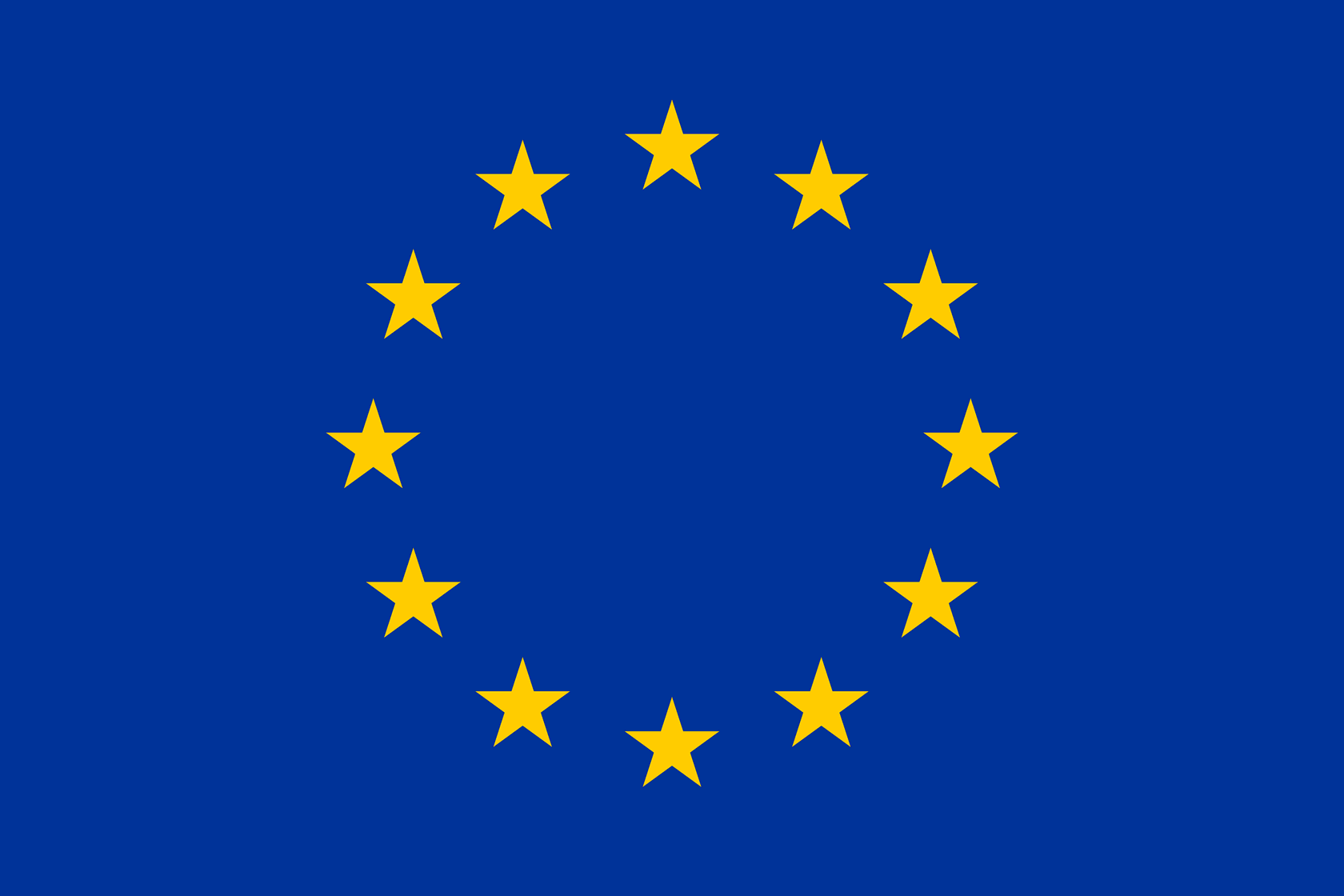Policies of arrival in Dortmund [EN translation]
Miriam Neßler, Cornelia Tippel und Jochen Schneider
The article is a product of scientific practice: Miriam Neßler and Cornelia Tippel are research assistants at ILS Research at the Institute for Regional and Urban Development Research in Dortmund, Jochen Schneider is a social planner in Dortmund's social department. On the research side, the article was written as part of two research projects: AIMEC (Arrival Infrastructures and Migrant Newcomers in European Cities, ESRC-funded) and ReROOT (Arrival Infrastructures as Sites of Integration for Recent Newcomers, EU-funded, Grant Agreement No. 101004704). We would like to thank Lara Hartig, student assistant in the AIMEC project, for her support with this article.
Summary
Organizing and facilitating the arrival of newcomers has long since become an ongoing task for many municipalities in Germany. Using the example of the North Rhine-Westphalian city of Dortmund, we show how policies of arrival are being developed at the municipal level with the aim of facilitating the arrival and participation of newcomers. Based on the overall strategy for new immigration, the service center for migration and integration MigraDO and the welcome network lokal willkommen, the chapter deals with the main features and areas of tension of Dortmund's arrival policy.
This version of the article has been accepted for publication, after peer review and is subject to Springer Nature’s AM terms of use, but is not the Version of Record and does not reflect post-acceptance improvements, or any corrections. The Version of Record is available online at: https://doi.org/10.1007/978-3-658-43195-2_47-1
Politiken des Ankommens in Dortmund
Miriam Neßler, Cornelia Tippel und Jochen Schneider
Der Beitrag ist ein Wissenschafts-Praxis-Produkt: Miriam Neßler und Cornelia Tippel sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bei der ILS Research am Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund, Jochen Schneider ist Sozialplaner im Dortmunder Sozialdezernat. Forschungsseitig entstand der Beitrag im Rahmen zweier Forschungsprojekte: AIMEC (Arrival Infrastructures and Migrant Newcomers in European Cities, ESRC-gefördert) und ReROOT (Arrival Infrastructures as Sites of Integration for Recent Newcomers, EU-gefördert, Grant Agreement No. 101004704). Für die Unterstützung bei diesem Beitrag danken wir Lara Hartig, studentische Mitarbeiterin im AIMEC-Projekt.
Zusammenfassung
Das Ankommen neuzuwandernder Menschen zu gestalten und zu ermöglichen ist längst zur Daueraufgabe vieler Kommunen in Deutschland geworden. Am Beispiel der nordrhein-westfälischen Stadt Dortmund zeigen wir auf, wie auf kommunaler Ebene Politiken des Ankommens entwickelt werden, die darauf abzielen, das Ankommen und die Teilhabe von Neuzugewanderten zu ermöglichen. Anhand der Gesamtstrategie Neuzuwanderung, dem Dienstleistungszentrum Migration und Integration MigraDO und dem Willkommensnetzwerk lokal willkommen behandelt das Kapitel Grundzüge und Spannungsfelder der Dortmunder Ankunftspolitik.
Schlüsselwörter
Ankommenspolitiken · Teilhabe · (Erst-)Integration · Dortmund · Good Practice
Miriam Neßler, Cornelia Tippel und Jochen Schneider
The article is a product of scientific practice: Miriam Neßler and Cornelia Tippel are research assistants at ILS Research at the Institute for Regional and Urban Development Research in Dortmund, Jochen Schneider is a social planner in Dortmund's social department. On the research side, the article was written as part of two research projects: AIMEC (Arrival Infrastructures and Migrant Newcomers in European Cities, ESRC-funded) and ReROOT (Arrival Infrastructures as Sites of Integration for Recent Newcomers, EU-funded, Grant Agreement No. 101004704). We would like to thank Lara Hartig, student assistant in the AIMEC project, for her support with this article.
Summary
Organizing and facilitating the arrival of newcomers has long since become an ongoing task for many municipalities in Germany. Using the example of the North Rhine-Westphalian city of Dortmund, we show how policies of arrival are being developed at the municipal level with the aim of facilitating the arrival and participation of newcomers. Based on the overall strategy for new immigration, the service center for migration and integration MigraDO and the welcome network lokal willkommen, the chapter deals with the main features and areas of tension of Dortmund's arrival policy.
This version of the article has been accepted for publication, after peer review and is subject to Springer Nature’s AM terms of use, but is not the Version of Record and does not reflect post-acceptance improvements, or any corrections. The Version of Record is available online at: https://doi.org/10.1007/978-3-658-43195-2_47-1
Politiken des Ankommens in Dortmund
Miriam Neßler, Cornelia Tippel und Jochen Schneider
Der Beitrag ist ein Wissenschafts-Praxis-Produkt: Miriam Neßler und Cornelia Tippel sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bei der ILS Research am Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund, Jochen Schneider ist Sozialplaner im Dortmunder Sozialdezernat. Forschungsseitig entstand der Beitrag im Rahmen zweier Forschungsprojekte: AIMEC (Arrival Infrastructures and Migrant Newcomers in European Cities, ESRC-gefördert) und ReROOT (Arrival Infrastructures as Sites of Integration for Recent Newcomers, EU-gefördert, Grant Agreement No. 101004704). Für die Unterstützung bei diesem Beitrag danken wir Lara Hartig, studentische Mitarbeiterin im AIMEC-Projekt.
Zusammenfassung
Das Ankommen neuzuwandernder Menschen zu gestalten und zu ermöglichen ist längst zur Daueraufgabe vieler Kommunen in Deutschland geworden. Am Beispiel der nordrhein-westfälischen Stadt Dortmund zeigen wir auf, wie auf kommunaler Ebene Politiken des Ankommens entwickelt werden, die darauf abzielen, das Ankommen und die Teilhabe von Neuzugewanderten zu ermöglichen. Anhand der Gesamtstrategie Neuzuwanderung, dem Dienstleistungszentrum Migration und Integration MigraDO und dem Willkommensnetzwerk lokal willkommen behandelt das Kapitel Grundzüge und Spannungsfelder der Dortmunder Ankunftspolitik.
Schlüsselwörter
Ankommenspolitiken · Teilhabe · (Erst-)Integration · Dortmund · Good Practice
1 Einleitung
In den Jahren 2012 bis 2022 sind mehr als 16 Mio. Menschen aus dem Ausland in Deutschland angekommen, davon mehr als 14 Mio. Menschen mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit (Statistisches Bundesamt 2023). Als Einwanderungsland ist Deutschland nicht nur „ein Land mit Migrationshintergrund“, wie es Bundespräsident Steinmeier ausdrückte (Der Bundespräsident 2021), sondern auch eines, in dem kontinuierlich neue Menschen ankommen, die bleiben und auch wieder gehen. (Im)Migration findet auch jenseits der medial beachteten ‚Wellen‘ statt und wird im Kontext von Globalisierung und multiplen Krisen angesichts ökologischer, politischer und demografischer Umbrüche auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eher zu- als abnehmen. Das Ankommen von Neuzuwandernden zu gestalten, wird damit zur Daueraufgabe – auch und insbesondere für die lokale Politik.
Wie dieses Handbuch und seine Vorgänger eindrücklich zeigen, kommt der lokalen Ebene – den Städten und Gemeinden – in der Integrationspolitik eine besondere Bedeutung zu, wenn auch stark beeinflusst von Landes-, Bundes- und EU-Regelungen. Lokale Integrationspolitiken sind dabei „historisch gewissermaßen von Zuwanderungsfall zu Zuwanderungsfall“ (Bommes 2018, S. 107) gewachsen. Zudem hat Zuwanderung in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur zugenommen, sondern sich auch diversifiziert – z. B. in Bezug auf Herkunftsländer, sozioökonomische Merkmale und Migrationsgründe. Dabei ist eine Gleichzeitigkeit und Überlappung verschiedener Migrationsbewegungen zu beobachten. Integrationspolitik ist kontinuierlich gefordert, auf dynamische Veränderungen im Zuwanderungsgeschehen zu reagieren. Die lokale Situation unterliegt dabei ständigen Veränderungen aufgrund überlokaler Politiken, geopolitischer Entwicklungen und ökonomischer Umbrüche (Wilson 2022, S. 3459). Hier steht die lokale Politik vor der Herausforderung, mit dem Ankommen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Zugangsrechten und in unterschiedlichen Lebenslagen umzugehen.
Wie viele weitere deutsche (beispielsweise Berlin, Hanau, Mannheim, Saarbrücken, Leipzig) und europäische Städte (beispielsweise Barcelona, Brüssel, London) hat die Stadt Dortmund sich in den vergangenen Jahren explizit der Situation von Neuzuwandernden zugewandt, strukturelle Rahmenbedingungen analysiert und Strategien zur Steuerung des Ankommens entwickelt. In Kooperation mit der Zivilgesellschaft entstanden in den letzten zehn Jahren eine Vielzahl an lokalen Strukturen, die das Ankommen Neuzugewanderter ermöglichen und erleichtern sollen. Dieses Paket von Maßnahmen bezeichnen wir hier als Politiken des Ankommens, deren Ziel es ist, einen frühzeitigen Zugang zu Wohnraum, Arbeit, Bildung und anderen Ressourcen für Neuzugewanderte, orientiert an deren Bedürfnissen, zu ermöglichen. Die Phase des Ankommens nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Hier werden Weichen gestellt, und möglicherweise auch bestehende Ungleichheiten fortgeführt, verstärkt oder sogar neue produziert.
Forschungen verweisen in dem Kontext auf die zentrale Rolle sog. Ankunftsinfrastrukturen als „derjenigen Teile des städtischen Gefüges, mit denen Ankommende bei ihrer Ankunft in Beziehung treten und in denen ihre künftige lokale oder translokale soziale Mobilität sowohl produziert als auch ausgehandelt wird“ (Meeus et al. 2019, S. 1, eigene Übersetzung). Ankunftsinfrastrukturen können dabei inkludierende und exkludierende Wirkungen für unterschiedliche Gruppen haben (Meeus et al. 2019; El-Kayed und Keskinkılıc 2023). Ankunftsinfrastrukturen befinden sich häufig in sog. Ankunftsstadtteilen oder Ankunftsquartieren.[1] Insbesondere in Vierteln, die bereits seit Jahrzehnten von Migration geprägt sind, spielen soziale Netzwerke und Orte, die von bereits länger etablierten Bewohnenden mit und ohne Migrationserfahrung initiiert wurden, eine bedeutende Rolle für das Ankommen von Neuzugewanderten (Hans et al. 2019; Hanhörster und Wessendorf 2020). Neuere Studien konstatieren eine soziale und räumliche Diversifizierung von Migrationsprozessen sowie des städtischen Zusammenlebens (Vertovec 2015). Dies beinhaltet, dass zunehmend auch Menschen ohne bestehende soziale Netzwerke ankommen, die in besonderem Maße auf sichtbare und zugängliche Ankunftsinfrastrukturen angewiesen sind (Wessendorf 2020). Durch Verteilungsmechanismen und Wohnungsmarktentwicklungen kommt es außerdem zum verstärkten Zuzug von Neuzugewanderten in Quartiere und Städte, die bislang kaum von Migration geprägt waren. Auch in diesen sog. neuen Ankunftsquartieren kommt staatlichen und staatlich finanzierten Strukturen zunehmend eine besondere Bedeutung zu (El-Kayed et al. 2020).
Ähnlich wie Integration ist der Begriff des Ankommens unscharf umrissen und unterliegt wechselnden politischen Vorstellungen und Kompetenzverteilungen. Oft werden Politiken des Ankommens unter dem Stichwort Erstintegration als ein Bestandteil des Integrationsprozesses gefasst. So auch im Nationalen Aktionsplan Integration von 2020, in dem Ankommen v. a. mit dem Spracherwerb und einer Wertevermittlung assoziiert wird (Die Bundesregierung 2020). In der nordrhein-westfälischen Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 wird – unter dem Schlagwort Erstintegration – die „systematische Erst- und Grundversorgung, insbesondere [...] rund um die Themenfelder Spracherwerb, Bildung, Gesundheit, Rechtsfragen, Wohnen, Verbraucherschutz und allgemeine Orientierungsleistungen“ (Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen 2019, S. 12) in den Blick genommen.
Auf der lokalen Ebene gibt es divergierende Herangehensweisen und Verständnisse, worin das Ankommen münden und ob und für wen es überhaupt ermöglicht werden soll, inwiefern bestimmte Strukturen das Ankommen also tatsächlich ermöglichen oder eher verunmöglichen (Felder et al. 2020). Das Dortmunder Ankommensverständnis ist breit und auf die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe von Anfang an ausgerichtet. Während Ankommen auf Landes- und Bundesebene einen Zeitraum von maximal drei Jahren umfasst, zeigen die Erfahrungen aus Dortmund, dass Menschen – insbesondere, wenn sie strukturell von Sprachkursen und anderen Maßnahmen ausgeschlossen sind, – teils dauerhafte Unterstützung durch Beratungsstellen benötigen (Stadt Dortmund 2022, S. 52). Das kommunale Verständnis von Ankommen richtet sich daher nicht auf einen bestimmten Zeitraum, sondern auf die Perspektive des Ressourcenzugangs, die v. a. in der Anfangszeit besonders notwendig ist.
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den Politiken des Ankommens in Dortmund. Zunächst stellen wir das Fallbeispiel der Stadt Dortmund, deren Geschichte und aktuelle Entwicklungen im Hinblick auf Migration und Integration sowie die Einbettung in überlokale Strukturen vor (Abschn. 2). Anschließend beleuchten wir zentrale Bausteine der Dortmunder Ankommenspolitiken (Abschn. 3). Im Anschluss werden Spannungsfelder lokaler Politiken des Ankommens diskutiert (Abschn. 4) und ein Fazit gezogen (Abschn. 5).
[1] Die Begriffe „Ankunftsstadtteil“ und „-quartier“ sowie „Ankunftsinfrastrukturen“ haben sich als wissenschaftliche Fachbegriffe etabliert. Abgesehen davon verwenden wir vorrangig den Terminus „Ankommen“, um die Prozesshaftigkeit des Ankommens auch nach der initialen Ankunft zu unterstreichen.
2 Das Fallbeispiel Dortmund
Dortmund ist mit knapp 610.000 Einwohnenden (Stadt Dortmund 2023a) die neuntgrößte Stadt Deutschlands und die bevölkerungsreichste Stadt des Ruhrgebiets. Geschichte und Gegenwart der Stadt sind von Migration geprägt (May 2002; Staubach 2014): Als Montanstandort war Dortmund Anziehungspunkt für Migrant*innen aus den damaligen östlichen preußischen Provinzen und Polen (sog. Ruhr-Polen), seit den 1960er-Jahren für sog. Gastarbeiter*innen aus südeuropäischen Ländern und der Türkei. In den 1980er-/1990er-Jahren kamen verstärkt Geflüchtete und Spätaussiedler*innen in die Stadt. Seit den 2000er- und v. a. den 2010er-Jahren ist Dortmund geprägt durch EU-Zuwanderung insbesondere aus Polen, Rumänien und Bulgarien im Kontext der EU-Erweiterungen und der späteren Arbeitnehmer*innenfreizügigkeit, aber auch aus Spanien in Folge der Weltwirtschaftskrise und der Coronapandemie (vgl. Abb. 1). Hinzu kommen Fluchtzuwanderungen der letzten zehn Jahre, v. a. aus Syrien und der Ukraine. Im Jahr 2022 lag der Anteil der Dortmunder*innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei mehr als 21 % (Stadt Dortmund 2023a). Der Stadtbezirk Innenstadt-Nord, Nordstadt genannt, gilt hierbei als „nahezu prototypischer Ankunftsstadtteil“ (Staubach 2014, S. 540), in dem sich Migration und Armut, aber auch eine Vielzahl formeller und informeller Ankunftsinfrastrukturen räumlich konzentrieren (Kurtenbach und Rosenberger 2021; Gerten et al. 2023).
In den Jahren 2012 bis 2022 sind mehr als 16 Mio. Menschen aus dem Ausland in Deutschland angekommen, davon mehr als 14 Mio. Menschen mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit (Statistisches Bundesamt 2023). Als Einwanderungsland ist Deutschland nicht nur „ein Land mit Migrationshintergrund“, wie es Bundespräsident Steinmeier ausdrückte (Der Bundespräsident 2021), sondern auch eines, in dem kontinuierlich neue Menschen ankommen, die bleiben und auch wieder gehen. (Im)Migration findet auch jenseits der medial beachteten ‚Wellen‘ statt und wird im Kontext von Globalisierung und multiplen Krisen angesichts ökologischer, politischer und demografischer Umbrüche auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eher zu- als abnehmen. Das Ankommen von Neuzuwandernden zu gestalten, wird damit zur Daueraufgabe – auch und insbesondere für die lokale Politik.
Wie dieses Handbuch und seine Vorgänger eindrücklich zeigen, kommt der lokalen Ebene – den Städten und Gemeinden – in der Integrationspolitik eine besondere Bedeutung zu, wenn auch stark beeinflusst von Landes-, Bundes- und EU-Regelungen. Lokale Integrationspolitiken sind dabei „historisch gewissermaßen von Zuwanderungsfall zu Zuwanderungsfall“ (Bommes 2018, S. 107) gewachsen. Zudem hat Zuwanderung in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur zugenommen, sondern sich auch diversifiziert – z. B. in Bezug auf Herkunftsländer, sozioökonomische Merkmale und Migrationsgründe. Dabei ist eine Gleichzeitigkeit und Überlappung verschiedener Migrationsbewegungen zu beobachten. Integrationspolitik ist kontinuierlich gefordert, auf dynamische Veränderungen im Zuwanderungsgeschehen zu reagieren. Die lokale Situation unterliegt dabei ständigen Veränderungen aufgrund überlokaler Politiken, geopolitischer Entwicklungen und ökonomischer Umbrüche (Wilson 2022, S. 3459). Hier steht die lokale Politik vor der Herausforderung, mit dem Ankommen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Zugangsrechten und in unterschiedlichen Lebenslagen umzugehen.
Wie viele weitere deutsche (beispielsweise Berlin, Hanau, Mannheim, Saarbrücken, Leipzig) und europäische Städte (beispielsweise Barcelona, Brüssel, London) hat die Stadt Dortmund sich in den vergangenen Jahren explizit der Situation von Neuzuwandernden zugewandt, strukturelle Rahmenbedingungen analysiert und Strategien zur Steuerung des Ankommens entwickelt. In Kooperation mit der Zivilgesellschaft entstanden in den letzten zehn Jahren eine Vielzahl an lokalen Strukturen, die das Ankommen Neuzugewanderter ermöglichen und erleichtern sollen. Dieses Paket von Maßnahmen bezeichnen wir hier als Politiken des Ankommens, deren Ziel es ist, einen frühzeitigen Zugang zu Wohnraum, Arbeit, Bildung und anderen Ressourcen für Neuzugewanderte, orientiert an deren Bedürfnissen, zu ermöglichen. Die Phase des Ankommens nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Hier werden Weichen gestellt, und möglicherweise auch bestehende Ungleichheiten fortgeführt, verstärkt oder sogar neue produziert.
Forschungen verweisen in dem Kontext auf die zentrale Rolle sog. Ankunftsinfrastrukturen als „derjenigen Teile des städtischen Gefüges, mit denen Ankommende bei ihrer Ankunft in Beziehung treten und in denen ihre künftige lokale oder translokale soziale Mobilität sowohl produziert als auch ausgehandelt wird“ (Meeus et al. 2019, S. 1, eigene Übersetzung). Ankunftsinfrastrukturen können dabei inkludierende und exkludierende Wirkungen für unterschiedliche Gruppen haben (Meeus et al. 2019; El-Kayed und Keskinkılıc 2023). Ankunftsinfrastrukturen befinden sich häufig in sog. Ankunftsstadtteilen oder Ankunftsquartieren.[1] Insbesondere in Vierteln, die bereits seit Jahrzehnten von Migration geprägt sind, spielen soziale Netzwerke und Orte, die von bereits länger etablierten Bewohnenden mit und ohne Migrationserfahrung initiiert wurden, eine bedeutende Rolle für das Ankommen von Neuzugewanderten (Hans et al. 2019; Hanhörster und Wessendorf 2020). Neuere Studien konstatieren eine soziale und räumliche Diversifizierung von Migrationsprozessen sowie des städtischen Zusammenlebens (Vertovec 2015). Dies beinhaltet, dass zunehmend auch Menschen ohne bestehende soziale Netzwerke ankommen, die in besonderem Maße auf sichtbare und zugängliche Ankunftsinfrastrukturen angewiesen sind (Wessendorf 2020). Durch Verteilungsmechanismen und Wohnungsmarktentwicklungen kommt es außerdem zum verstärkten Zuzug von Neuzugewanderten in Quartiere und Städte, die bislang kaum von Migration geprägt waren. Auch in diesen sog. neuen Ankunftsquartieren kommt staatlichen und staatlich finanzierten Strukturen zunehmend eine besondere Bedeutung zu (El-Kayed et al. 2020).
Ähnlich wie Integration ist der Begriff des Ankommens unscharf umrissen und unterliegt wechselnden politischen Vorstellungen und Kompetenzverteilungen. Oft werden Politiken des Ankommens unter dem Stichwort Erstintegration als ein Bestandteil des Integrationsprozesses gefasst. So auch im Nationalen Aktionsplan Integration von 2020, in dem Ankommen v. a. mit dem Spracherwerb und einer Wertevermittlung assoziiert wird (Die Bundesregierung 2020). In der nordrhein-westfälischen Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 wird – unter dem Schlagwort Erstintegration – die „systematische Erst- und Grundversorgung, insbesondere [...] rund um die Themenfelder Spracherwerb, Bildung, Gesundheit, Rechtsfragen, Wohnen, Verbraucherschutz und allgemeine Orientierungsleistungen“ (Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen 2019, S. 12) in den Blick genommen.
Auf der lokalen Ebene gibt es divergierende Herangehensweisen und Verständnisse, worin das Ankommen münden und ob und für wen es überhaupt ermöglicht werden soll, inwiefern bestimmte Strukturen das Ankommen also tatsächlich ermöglichen oder eher verunmöglichen (Felder et al. 2020). Das Dortmunder Ankommensverständnis ist breit und auf die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe von Anfang an ausgerichtet. Während Ankommen auf Landes- und Bundesebene einen Zeitraum von maximal drei Jahren umfasst, zeigen die Erfahrungen aus Dortmund, dass Menschen – insbesondere, wenn sie strukturell von Sprachkursen und anderen Maßnahmen ausgeschlossen sind, – teils dauerhafte Unterstützung durch Beratungsstellen benötigen (Stadt Dortmund 2022, S. 52). Das kommunale Verständnis von Ankommen richtet sich daher nicht auf einen bestimmten Zeitraum, sondern auf die Perspektive des Ressourcenzugangs, die v. a. in der Anfangszeit besonders notwendig ist.
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den Politiken des Ankommens in Dortmund. Zunächst stellen wir das Fallbeispiel der Stadt Dortmund, deren Geschichte und aktuelle Entwicklungen im Hinblick auf Migration und Integration sowie die Einbettung in überlokale Strukturen vor (Abschn. 2). Anschließend beleuchten wir zentrale Bausteine der Dortmunder Ankommenspolitiken (Abschn. 3). Im Anschluss werden Spannungsfelder lokaler Politiken des Ankommens diskutiert (Abschn. 4) und ein Fazit gezogen (Abschn. 5).
[1] Die Begriffe „Ankunftsstadtteil“ und „-quartier“ sowie „Ankunftsinfrastrukturen“ haben sich als wissenschaftliche Fachbegriffe etabliert. Abgesehen davon verwenden wir vorrangig den Terminus „Ankommen“, um die Prozesshaftigkeit des Ankommens auch nach der initialen Ankunft zu unterstreichen.
2 Das Fallbeispiel Dortmund
Dortmund ist mit knapp 610.000 Einwohnenden (Stadt Dortmund 2023a) die neuntgrößte Stadt Deutschlands und die bevölkerungsreichste Stadt des Ruhrgebiets. Geschichte und Gegenwart der Stadt sind von Migration geprägt (May 2002; Staubach 2014): Als Montanstandort war Dortmund Anziehungspunkt für Migrant*innen aus den damaligen östlichen preußischen Provinzen und Polen (sog. Ruhr-Polen), seit den 1960er-Jahren für sog. Gastarbeiter*innen aus südeuropäischen Ländern und der Türkei. In den 1980er-/1990er-Jahren kamen verstärkt Geflüchtete und Spätaussiedler*innen in die Stadt. Seit den 2000er- und v. a. den 2010er-Jahren ist Dortmund geprägt durch EU-Zuwanderung insbesondere aus Polen, Rumänien und Bulgarien im Kontext der EU-Erweiterungen und der späteren Arbeitnehmer*innenfreizügigkeit, aber auch aus Spanien in Folge der Weltwirtschaftskrise und der Coronapandemie (vgl. Abb. 1). Hinzu kommen Fluchtzuwanderungen der letzten zehn Jahre, v. a. aus Syrien und der Ukraine. Im Jahr 2022 lag der Anteil der Dortmunder*innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei mehr als 21 % (Stadt Dortmund 2023a). Der Stadtbezirk Innenstadt-Nord, Nordstadt genannt, gilt hierbei als „nahezu prototypischer Ankunftsstadtteil“ (Staubach 2014, S. 540), in dem sich Migration und Armut, aber auch eine Vielzahl formeller und informeller Ankunftsinfrastrukturen räumlich konzentrieren (Kurtenbach und Rosenberger 2021; Gerten et al. 2023).

Abb. 1 Anzahl der zugezogenen Menschen nach Dortmund 2012–2022, nach häufigsten Staatsangehörigkeiten (ohne deutsch). (Quelle: Eigene Darstellung nach statistischen Daten der Stadt Dortmund)
und seiner Zuwanderungstradition verfügt Dortmund über eine entsprechend lange integrationspolitische Erfahrung. Das politische Grundklima gilt als sehr integrationsförderlich (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 2016, S. 49) und Diversität ist positiv konnotiert (Gesemann et al. 2019, S. 13–14). Im Masterplan Migration/Integration aus dem Jahr 2005 wird ein Verständnis von Integration vertreten, das eine „gleichberechtigte Teilhabe von Menschen unterschiedlicher Herkunft am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben in Dortmund auf der Grundlage der Werteordnung des Grundgesetzes“ (Stadt Dortmund 2006, S. 3) umfasst. Migrant*innen werden nicht, wie häufig, für das Gelingen von Integration verantwortlich gemacht. Stattdessen wird Integration als kommunale Dauer- und Querschnittsaufgabe behandelt, die fester Bestandteil der politischen Agenda und des kommunalen Haushalts ist und in der Zivilgesellschaft, insbesondere durch Migrant*innenselbstorganisationen, eine wichtige Rolle spielt.
Ermöglicht durch erhebliche Einsparungen ist Dortmund eine der wenigen Kommunen in der Region mit einem genehmigten Haushalt. Der selbstverwaltete Haushalt ermöglicht im Kontext lokaler Ankommenspolitiken einen gewissen Spielraum. Die aktuelle Herausbildung eines Handlungsfeldes Ankommen und Neuzuwanderung schreibt sich in den bisher beschrittenen „Pfad der Integration“ ein (Dymarz et al. 2018, S. 254). Sie hat sich insbesondere vor dem Hintergrund von Zuwanderung aus den EU-2-Staaten Südosteuropas und von Geflüchteten, v. a. aus Syrien, sowie den Synergien im Umgang mit verschiedenen Gruppen von Neuzuwandernden entwickelt. Im folgenden Kapitel werden kommunale Maßnahmen vorgestellt, die die Grundpfeiler der aktuellen Dortmunder Ankommenspolitiken bilden.
3 Grundpfeiler der Dortmunder Ankommenspolitiken
Mit der Gesamtstrategie Neuzuwanderung, dem Dienstleistungszentrum Migration und Integration MigraDO und dem Willkommensnetzwerk lokal willkommen stellen wir die wichtigsten Säulen der Dortmunder Ankommenspolitiken, einschließlich ihrer Genese, der Entwicklung der einzelnen Maßnahmen sowie ihrer Einbettung in lokale und überlokale Strukturen, vor.
3.1 Gesamtstrategie Neuzuwanderung
Den Kern der Dortmunder Ankommenspolitiken bildet die Gesamtstrategie Neuzuwanderung, die im Handlungsrahmen Neuzuwanderung (Stadt Dortmund 2013, 2023b) und in den jährlichen Sachstandsberichten (Stadt Dortmund 2020, 2021a, 2022) niedergelegt ist. Ausgangspunkt des Handlungsrahmens war die mit dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens in die Europäische Union 2007 verbundene Einführung der Freizügigkeit für Bürger*innen beider Länder 2014, mit der sich eine neue Zuwanderungsbewegung nach Dortmund entwickelte. Obwohl die Mehrheit der neuzugewanderten Menschen aus Rumänien und Bulgarien in Deutschland schnell Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt fand, entstanden in Dortmund und anderen Ruhrgebietsstädten neue Herausforderungen: Hier kamen überproportional viele Menschen an, die bereits in ihren Herkunftsländern von Ausgrenzung und Armut betroffen waren. Diese prekären Lebenslagen setzten sich in Dortmund fort. Gesetzliche Regelungsdefizite, die faktisch einen großen Teil der EU-Bürger*innen von Krankenversicherung, Sprachkursen, Arbeitsförderung, Grundsicherung und anderen Regelstrukturen ausschließen (Stadt Dortmund 2022, S. 59–61, 100), führten zu einer Verfestigung von Armut und Ausgrenzung.
und seiner Zuwanderungstradition verfügt Dortmund über eine entsprechend lange integrationspolitische Erfahrung. Das politische Grundklima gilt als sehr integrationsförderlich (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 2016, S. 49) und Diversität ist positiv konnotiert (Gesemann et al. 2019, S. 13–14). Im Masterplan Migration/Integration aus dem Jahr 2005 wird ein Verständnis von Integration vertreten, das eine „gleichberechtigte Teilhabe von Menschen unterschiedlicher Herkunft am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben in Dortmund auf der Grundlage der Werteordnung des Grundgesetzes“ (Stadt Dortmund 2006, S. 3) umfasst. Migrant*innen werden nicht, wie häufig, für das Gelingen von Integration verantwortlich gemacht. Stattdessen wird Integration als kommunale Dauer- und Querschnittsaufgabe behandelt, die fester Bestandteil der politischen Agenda und des kommunalen Haushalts ist und in der Zivilgesellschaft, insbesondere durch Migrant*innenselbstorganisationen, eine wichtige Rolle spielt.
Ermöglicht durch erhebliche Einsparungen ist Dortmund eine der wenigen Kommunen in der Region mit einem genehmigten Haushalt. Der selbstverwaltete Haushalt ermöglicht im Kontext lokaler Ankommenspolitiken einen gewissen Spielraum. Die aktuelle Herausbildung eines Handlungsfeldes Ankommen und Neuzuwanderung schreibt sich in den bisher beschrittenen „Pfad der Integration“ ein (Dymarz et al. 2018, S. 254). Sie hat sich insbesondere vor dem Hintergrund von Zuwanderung aus den EU-2-Staaten Südosteuropas und von Geflüchteten, v. a. aus Syrien, sowie den Synergien im Umgang mit verschiedenen Gruppen von Neuzuwandernden entwickelt. Im folgenden Kapitel werden kommunale Maßnahmen vorgestellt, die die Grundpfeiler der aktuellen Dortmunder Ankommenspolitiken bilden.
3 Grundpfeiler der Dortmunder Ankommenspolitiken
Mit der Gesamtstrategie Neuzuwanderung, dem Dienstleistungszentrum Migration und Integration MigraDO und dem Willkommensnetzwerk lokal willkommen stellen wir die wichtigsten Säulen der Dortmunder Ankommenspolitiken, einschließlich ihrer Genese, der Entwicklung der einzelnen Maßnahmen sowie ihrer Einbettung in lokale und überlokale Strukturen, vor.
3.1 Gesamtstrategie Neuzuwanderung
Den Kern der Dortmunder Ankommenspolitiken bildet die Gesamtstrategie Neuzuwanderung, die im Handlungsrahmen Neuzuwanderung (Stadt Dortmund 2013, 2023b) und in den jährlichen Sachstandsberichten (Stadt Dortmund 2020, 2021a, 2022) niedergelegt ist. Ausgangspunkt des Handlungsrahmens war die mit dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens in die Europäische Union 2007 verbundene Einführung der Freizügigkeit für Bürger*innen beider Länder 2014, mit der sich eine neue Zuwanderungsbewegung nach Dortmund entwickelte. Obwohl die Mehrheit der neuzugewanderten Menschen aus Rumänien und Bulgarien in Deutschland schnell Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt fand, entstanden in Dortmund und anderen Ruhrgebietsstädten neue Herausforderungen: Hier kamen überproportional viele Menschen an, die bereits in ihren Herkunftsländern von Ausgrenzung und Armut betroffen waren. Diese prekären Lebenslagen setzten sich in Dortmund fort. Gesetzliche Regelungsdefizite, die faktisch einen großen Teil der EU-Bürger*innen von Krankenversicherung, Sprachkursen, Arbeitsförderung, Grundsicherung und anderen Regelstrukturen ausschließen (Stadt Dortmund 2022, S. 59–61, 100), führten zu einer Verfestigung von Armut und Ausgrenzung.

Abb. 2 Handlungsfelder der Gesamtstrategie Neuzuwanderung. (Quelle: Eigene Darstellung, nach Stadt Dortmund 2023b)
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, entstand 2011 in Dortmund ein Netzwerk aus städtischer Verwaltung, Trägern der freien Wohlfahrtspflege und vielen weiteren Akteur*innen (Vereine, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Polizei, Staatsanwaltschaft, Kammern, Kliniken u. v. m.). In den Jahren 2012/2013 wurde im Netzwerk unter Federführung des Sozialdezernats der Stadt der „Handlungsrahmen Zuwanderung aus Südosteuropa“ (Stadt Dortmund 2013) entwickelt, der zunächst sechs Handlungsfelder umfasste und die Grundlage für konkrete Maßnahmen bildete. Die Maßnahmen und Angebote sollen neuzugewanderten Menschen möglichst bald nach ihrer Ankunft Orientierung und Unterstützung anbieten, auch um zu verhindern, dass sie ausbeuterischen Strukturen ausgesetzt sind. Daneben gibt es aber auch Maßnahmen und Angebote, die einen Mangel in den Regelstrukturen, die insbesondere Neuzugewanderte betreffen, kompensieren sollen. Als im Rahmen der Fluchtzuwanderung in den Jahren 2015/2016 Synergien in der Arbeit mit den Zielgruppen aus verschiedenen Zuwanderungskontexten evident wurden, sorgte die Verschneidung der Bereiche dafür, dass Expertise der etablierten Strukturen auch bei der Versorgung und Integration von Geflüchteten nutzbar gemacht werden konnte. Im aktuellen Handlungsrahmen (Stand: 2023), der die strategischen Herausforderungen für die kommenden Jahre definiert, wird die Orientierung an unterschiedlichen Gruppen von Neuzugewanderten über Aufenthaltstitel hinweg daher als wichtiges Element verankert.
Thematische Fachgruppen in derzeit neun Handlungsfeldern (siehe Abb. 2) sollen das Wissen verschiedener Fachleute bündeln, Lösungsansätze in einzelnen Themenfeldern entwickeln und die unterschiedlichen Maßnahmen koordinieren. Die Koordinator*innen der Handlungsfelder nehmen ihre Aufgabe jeweils im Tandem aus Verwaltung und freien Trägern wahr und sollen so eine gemeinsame Verantwortung und Verankerung der Arbeit gewährleisten. Träger- und organisationsübergreifende Kooperation äußert sich nicht nur in der Netzwerksteuerung, sondern auch in zahlreichen Projekten wie der in der Nordstadt gelegenen ökumenischen Anlaufstelle Willkommen Europa. Aufgrund dieser Zusammenarbeit wird auch vom „Dortmunder Modell“ (Merkel und Smith 2023) gesprochen. Die im Sozialdezernat verortete Gesamtkoordinierung bereitet die Ergebnisse der Koordinierungsgruppen und Informationen über aktuelle Entwicklungen in den Handlungsfeldern auf lokaler und überlokaler Ebene auf und sorgt für eine Verzahnung auf Leitungsebene mit anderen Verwaltungsstrukturen wie dem Jugendamt, dem Jobcenter, den Wohlfahrtsverbänden und der Fachhochschule Dortmund. Durch jährliche Sachstandsberichte, die Information politischer Gremien, Fachpublikationen (wie beispielsweise Certa 2014; Zoerner und Certa 2020), die Teilnahme an Konferenzen und die Arbeit in Städtenetzwerken wird die lokale Antwort laufend reflektiert, aber auch in größere strukturelle Zusammenhänge eingeordnet.
Im Kontext der Gesamtstrategie wird daran gearbeitet, ein umfassendes und den Bedarfen entsprechendes Gesamtangebot zu entwickeln, sich ändernde Rahmenbedingungen prospektiv zu erkennen und die aufgebauten Strukturen flexibel an bestehende Bedarfe anzupassen. Damit verbunden ist auch die Akquise von Projektmitteln aufgrund geringer finanzieller Spielräume im kommunalen Haushalt. Eine Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen zum Aufbau eines „Kommunalen Integrationsmanagements“ hilft bei der Finanzierung der Gesamtstrategie durch den Ausbau der operativen Kapazitäten, die Verbesserung der Strukturen des Case Managements und die Verknüpfung der zentralen und dezentralen Ankommensstrukturen, um die operativen Strukturen weiterzuentwickeln.
Grundsätzlich ist der Großteil der Gesamtstrategie jedoch auf kontinuierliche erfolgreiche Akquisen von Fördergeldern und eine Fortsetzung von Förderprogrammen angewiesen. Seit Beginn der Gesamtstrategie mussten mehr als 27,8 Mio. Euro Fördergelder für Projekte eingeworben werden (Stand 12/2020; Stadt Dortmund 2022, S. 82), um notwendige Maßnahmen zu implementieren. Diese umfassen neben Beratungsangeboten auch Kompensationsmaßnahmen von rechtlich und/oder faktisch unzugänglichen Regelstrukturen (z. B. medizinische Untersuchungen für nicht-krankenversicherte Kinder und Erwachsene, Brückenprojekte im Übergang zu Kinderbetreuung oder Schule). Ziel ist es, neben der Beibehaltung besonderer zielgruppenspezifischer Angebote, erfolgreiche Unterstützungs- und Beratungsangebote zu verstetigen, aber auch eine Öffnung, Erweiterung und bedarfsgerechte Kapazitätsausstattung der Regelstrukturen zu erwirken. Dafür wird die interkommunale Vernetzung (z. B. im Deutschen Städtetag) und der Dialog mit Landes- und Bundesministerien vorangetrieben. Ein wichtiges Prinzip der Gesamtstrategie ist es damit, neben einer Verankerung von Ankommenspolitiken auf der lokalen Ebene auch auf Regelungsdefizite und eine ebenenübergreifende Verantwortung aufmerksam zu machen und so Einfluss auf die höheren Politikebenen zu nehmen (Stadt Dortmund 2023b).
3.2 Dienstleistungszentrum Migration und Integration MigraDO
Insbesondere die Fluchtzuwanderung der Jahre 2015 und 2016 stellte eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar, deren Bewältigung personelle und finanzielle Ressourcen gebunden und – trotz des enormen Engagements und der Hilfsbereitschaft – organisatorische Defizite offenbart hat. Auch in Dortmund versuchten Politik und Verwaltung, durch eine engmaschige Kooperation verschiedener kommunaler Fachbereiche Abstimmungs- und Schnittstellenproblematiken zukünftig zu verringern. Mit einem Krisenstabsbeschluss wurde 2018 eine Projektgruppe mit der Erstellung eines Organisationsvorschlags zur Einrichtung eines Dienstleistungszentrums Migration und Integration beauftragt. Ziel des Projektes sollte zunächst sein, den Ablauf des Ankommens von Geflüchteten so zu gestalten, dass Probleme für die Zielgruppe, für die zuständigen Beschäftigten, aber auch für die begleitenden Ehrenamtlichen so gering wie möglich gehalten und von Anfang an Weichen für notwendige Integrationsschritte gestellt werden. Hintergrund waren die Beobachtungen sowohl des Krisenstabs als auch durch die systematische Rekonstruktion besonders komplizierter Fälle, dass die Überwindung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Ämtern und Anlaufstellen oft zu Problemen führten. Anfangs eingeschlagene Pfade und Fehler konnten später schwer korrigiert werden und zu einer Verfestigung von Problemlagen oder zu einer gegenseitigen Behinderung behördlicher Prozesse führen (z. B. bei unpassender ausländerrechtlicher Kategorisierung). Es sollte ebenfalls das mehrfache Aufsuchen unterschiedlicher Anlaufstellen mit derselben Problematik vermieden werden.
Die Krisenstabsstruktur wurde in ein Projektformat überführt, um bei Veränderungen der Rahmenbedingungen flexibel reagieren zu können. Darin arbeiteten von 2018 bis 2020 Vertreter*innen der Ausländerbehörde, des Sozialamts, des Schulamts, des Jugendamts, des Sozialdezernats sowie des Jobcenters und wechselnder Partner*innen an der Konzeptionalisierung und Umsetzung eines Dienstleistungszentrums Migration und Integration. Hierzu wurde nicht nur intern an den eigenen Prozessen gearbeitet, sondern es wurden auch bestehende Formate studiert: Erkenntnisse aus den Besuchen beim „Haus der Integration“ in Wuppertal und dem „Service Point“ der Stadt Düsseldorf sind in die Entwicklung eingeflossen. Darüber hinaus wurde die Stadt als eine von 14 Partnerstädten in das Projekt „CONNEcting Cities Towards IntegratiON“ (CONNECTION, Laufzeit 2020–2022) aufgenommen. Unter der Federführung des europäischen Städtenetzwerks EUROCITIES zielt das Projekt darauf ab, die Kapazitäten von Städten zur Integration von Migrant*innen zu stärken.
Das Dienstleistungszentrum Migration und Integration MigraDO wurde im Jahr 2022 eröffnet. Ursprünglich sollte sich die Anlaufstelle nur an Geflüchtete richten. Da jedoch in der Planungsphase die Zahl der Geflüchteten zurückging und in erster Linie Geduldete nach Dortmund zugewiesen wurden sowie gleichzeitig vermehrt EU-Bürger*innen zuzogen, wurde die Zielgruppe früh auf alle aus dem In- und Ausland nach Dortmund Zuziehenden erweitert. So stand sie auch ukrainischen Geflüchteten offen, die zeitgleich mit der Eröffnung des MigraDO in Dortmund ankamen.
Das Dienstleistungszentrum liegt in der Innenstadt in direkter räumlicher Nähe zu den Bürgerdiensten und der Ausländerbehörde. Von dort aus werden Zuziehende idealerweise direkt zur Erstberatung von MigraDO weitergeleitet. Die melderechtliche Anmeldung von EU-Bürger*innen findet sogar in denselben Räumlichkeiten statt. Die Anlaufstelle fungiert dabei als sog. One-Stop-Shop, in dem der spezifische Unterstützungsbedarf beim Ankommen des Haushaltes in einzelnen Lebensbereichen (z. B. Schule, Wohnen, Spracherwerb, Pflegebedarf) an einer zentralen Anlaufstelle eruiert wird. Die darauffolgende Unterstützung reicht von der qualifizierten Verweisberatung zu anderen zuständigen Stellen bis hin zum Case Management. Das Dienstleistungszentrum MigraDO zeigt zum einen, wie eine Anpassung an verändernde Zielgruppen und eine Reaktion auf Ankommensbedarfe auch über verschiedene Gruppen hinweg gelingen können. Zum anderen wurde mit dem Projekt explizit das initiale Ankommen in den Blick genommen, bei dem die melderechtliche Anmeldung als eine wichtige Stellschraube fungiert.
3.3 Willkommensnetzwerk lokal willkommen
Im Gegensatz zum One-Stop-Shop MigraDO verfolgt das Willkommensnetzwerk lokal willkommen von Anfang an einen dezentralen Ansatz. Es entstand ebenfalls im Kontext der Fluchtzuwanderung um 2015, als Geflüchtete oftmals mit Unterstützung durch Haupt- und Ehrenamtliche von der Gemeinschaftsunterkunft in eine selbst angemietete Wohnung umzogen und in unterschiedlichen Nachbarschaften Fuß fassten. In den Quartieren, wo die Menschen zusammenleben, stellen sich die Weichen für den weiteren Integrationserfolg.
Im Jahr 2015 beauftragte der Rat der Stadt die Verwaltung, ein Konzept für ein lokales Integrationsnetzwerk für Geflüchtete mit dem Ziel zu entwickeln, in allen Stadtbezirken bzw. Wohnquartieren qualitative und gleiche Startchancen für Geflüchtete zu schaffen: Dezentralität und Wohnortnähe sind Grundgedanken des Netzwerks. Gerade wenn Geflüchtete – aufgrund der Standorte von Unterbringungseinrichtungen, Wohnungsmarktentwicklungen oder anderer Faktoren – abseits von traditionellen Ankunftsquartieren unterkommen, ist es wichtig, den Zugang zu Beratungsstrukturen sicherzustellen. Lokal willkommen sollte dementsprechend als wohnortnahe Anlaufstelle Geflüchteten mit Beratungsbedarf sowie Bürger*innen und Anwohner*innen, die sich engagieren wollen oder Fragen haben, einen niederschwelligen Ort bieten, um ihre Anliegen vorzubringen.
Aus diesen Leitgedanken entwickelte sich das Pilotprojekt lokal willkommen, eine städtische Kooperation mit den Wohlfahrtsverbänden und weiteren Partner*innen, dessen erstes Standortlokal 2016 eröffnete. Bereits 2017 wurde lokal willkommen in den kommunal-finanzierten Regelbetrieb (ergänzt durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds des Bundes) überführt und von da an sukzessive auf alle Stadtbezirke ausgeweitet. Seit 2021 ist das Integrationsnetzwerk in allen Stadtteilen präsent (siehe Abb. 3). Dabei unterstützt es einerseits Geflüchtete im Rahmen der Beratung bei der Bearbeitung ihrer individuellen Bedarfe und arbeitet gleichzeitig mit Kirchengemeinden, Initiativen, Verbänden, Sportvereinen, Vermieter*innen und weiteren Akteur*innen auf lokaler Ebene eng zusammen, um einen Beitrag zur Mobilisierung und Stärkung der Gemeinwesenarbeit zu leisten (Stadt Dortmund 2021b). In den Augen der Betreibenden werden die Büros des Integrationsnetzwerks sowohl von neuzugezogenen als auch von alteingesessenen Einwohner*innen gut angenommen und dienen der Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Insbesondere der Beratungsbedarf bei neuzugezogenen Menschen zeigte sich durchgängig als sehr hoch: Von Oktober 2016 bis August 2022 wurden durch die sieben lokalen Standorte über 4.500 Haushalte mit über 13.000 Personen informiert und beraten. An den Standorten zeigt sich auch, wie Neuzugezogene dabei nach einiger Zeit selbst zu (ehrenamtlichen) Unterstützer*innen werden, die ihr Wissen weitergeben und aktiver Teil der Strukturen werden.
Thematische Fachgruppen in derzeit neun Handlungsfeldern (siehe Abb. 2) sollen das Wissen verschiedener Fachleute bündeln, Lösungsansätze in einzelnen Themenfeldern entwickeln und die unterschiedlichen Maßnahmen koordinieren. Die Koordinator*innen der Handlungsfelder nehmen ihre Aufgabe jeweils im Tandem aus Verwaltung und freien Trägern wahr und sollen so eine gemeinsame Verantwortung und Verankerung der Arbeit gewährleisten. Träger- und organisationsübergreifende Kooperation äußert sich nicht nur in der Netzwerksteuerung, sondern auch in zahlreichen Projekten wie der in der Nordstadt gelegenen ökumenischen Anlaufstelle Willkommen Europa. Aufgrund dieser Zusammenarbeit wird auch vom „Dortmunder Modell“ (Merkel und Smith 2023) gesprochen. Die im Sozialdezernat verortete Gesamtkoordinierung bereitet die Ergebnisse der Koordinierungsgruppen und Informationen über aktuelle Entwicklungen in den Handlungsfeldern auf lokaler und überlokaler Ebene auf und sorgt für eine Verzahnung auf Leitungsebene mit anderen Verwaltungsstrukturen wie dem Jugendamt, dem Jobcenter, den Wohlfahrtsverbänden und der Fachhochschule Dortmund. Durch jährliche Sachstandsberichte, die Information politischer Gremien, Fachpublikationen (wie beispielsweise Certa 2014; Zoerner und Certa 2020), die Teilnahme an Konferenzen und die Arbeit in Städtenetzwerken wird die lokale Antwort laufend reflektiert, aber auch in größere strukturelle Zusammenhänge eingeordnet.
Im Kontext der Gesamtstrategie wird daran gearbeitet, ein umfassendes und den Bedarfen entsprechendes Gesamtangebot zu entwickeln, sich ändernde Rahmenbedingungen prospektiv zu erkennen und die aufgebauten Strukturen flexibel an bestehende Bedarfe anzupassen. Damit verbunden ist auch die Akquise von Projektmitteln aufgrund geringer finanzieller Spielräume im kommunalen Haushalt. Eine Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen zum Aufbau eines „Kommunalen Integrationsmanagements“ hilft bei der Finanzierung der Gesamtstrategie durch den Ausbau der operativen Kapazitäten, die Verbesserung der Strukturen des Case Managements und die Verknüpfung der zentralen und dezentralen Ankommensstrukturen, um die operativen Strukturen weiterzuentwickeln.
Grundsätzlich ist der Großteil der Gesamtstrategie jedoch auf kontinuierliche erfolgreiche Akquisen von Fördergeldern und eine Fortsetzung von Förderprogrammen angewiesen. Seit Beginn der Gesamtstrategie mussten mehr als 27,8 Mio. Euro Fördergelder für Projekte eingeworben werden (Stand 12/2020; Stadt Dortmund 2022, S. 82), um notwendige Maßnahmen zu implementieren. Diese umfassen neben Beratungsangeboten auch Kompensationsmaßnahmen von rechtlich und/oder faktisch unzugänglichen Regelstrukturen (z. B. medizinische Untersuchungen für nicht-krankenversicherte Kinder und Erwachsene, Brückenprojekte im Übergang zu Kinderbetreuung oder Schule). Ziel ist es, neben der Beibehaltung besonderer zielgruppenspezifischer Angebote, erfolgreiche Unterstützungs- und Beratungsangebote zu verstetigen, aber auch eine Öffnung, Erweiterung und bedarfsgerechte Kapazitätsausstattung der Regelstrukturen zu erwirken. Dafür wird die interkommunale Vernetzung (z. B. im Deutschen Städtetag) und der Dialog mit Landes- und Bundesministerien vorangetrieben. Ein wichtiges Prinzip der Gesamtstrategie ist es damit, neben einer Verankerung von Ankommenspolitiken auf der lokalen Ebene auch auf Regelungsdefizite und eine ebenenübergreifende Verantwortung aufmerksam zu machen und so Einfluss auf die höheren Politikebenen zu nehmen (Stadt Dortmund 2023b).
3.2 Dienstleistungszentrum Migration und Integration MigraDO
Insbesondere die Fluchtzuwanderung der Jahre 2015 und 2016 stellte eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar, deren Bewältigung personelle und finanzielle Ressourcen gebunden und – trotz des enormen Engagements und der Hilfsbereitschaft – organisatorische Defizite offenbart hat. Auch in Dortmund versuchten Politik und Verwaltung, durch eine engmaschige Kooperation verschiedener kommunaler Fachbereiche Abstimmungs- und Schnittstellenproblematiken zukünftig zu verringern. Mit einem Krisenstabsbeschluss wurde 2018 eine Projektgruppe mit der Erstellung eines Organisationsvorschlags zur Einrichtung eines Dienstleistungszentrums Migration und Integration beauftragt. Ziel des Projektes sollte zunächst sein, den Ablauf des Ankommens von Geflüchteten so zu gestalten, dass Probleme für die Zielgruppe, für die zuständigen Beschäftigten, aber auch für die begleitenden Ehrenamtlichen so gering wie möglich gehalten und von Anfang an Weichen für notwendige Integrationsschritte gestellt werden. Hintergrund waren die Beobachtungen sowohl des Krisenstabs als auch durch die systematische Rekonstruktion besonders komplizierter Fälle, dass die Überwindung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Ämtern und Anlaufstellen oft zu Problemen führten. Anfangs eingeschlagene Pfade und Fehler konnten später schwer korrigiert werden und zu einer Verfestigung von Problemlagen oder zu einer gegenseitigen Behinderung behördlicher Prozesse führen (z. B. bei unpassender ausländerrechtlicher Kategorisierung). Es sollte ebenfalls das mehrfache Aufsuchen unterschiedlicher Anlaufstellen mit derselben Problematik vermieden werden.
Die Krisenstabsstruktur wurde in ein Projektformat überführt, um bei Veränderungen der Rahmenbedingungen flexibel reagieren zu können. Darin arbeiteten von 2018 bis 2020 Vertreter*innen der Ausländerbehörde, des Sozialamts, des Schulamts, des Jugendamts, des Sozialdezernats sowie des Jobcenters und wechselnder Partner*innen an der Konzeptionalisierung und Umsetzung eines Dienstleistungszentrums Migration und Integration. Hierzu wurde nicht nur intern an den eigenen Prozessen gearbeitet, sondern es wurden auch bestehende Formate studiert: Erkenntnisse aus den Besuchen beim „Haus der Integration“ in Wuppertal und dem „Service Point“ der Stadt Düsseldorf sind in die Entwicklung eingeflossen. Darüber hinaus wurde die Stadt als eine von 14 Partnerstädten in das Projekt „CONNEcting Cities Towards IntegratiON“ (CONNECTION, Laufzeit 2020–2022) aufgenommen. Unter der Federführung des europäischen Städtenetzwerks EUROCITIES zielt das Projekt darauf ab, die Kapazitäten von Städten zur Integration von Migrant*innen zu stärken.
Das Dienstleistungszentrum Migration und Integration MigraDO wurde im Jahr 2022 eröffnet. Ursprünglich sollte sich die Anlaufstelle nur an Geflüchtete richten. Da jedoch in der Planungsphase die Zahl der Geflüchteten zurückging und in erster Linie Geduldete nach Dortmund zugewiesen wurden sowie gleichzeitig vermehrt EU-Bürger*innen zuzogen, wurde die Zielgruppe früh auf alle aus dem In- und Ausland nach Dortmund Zuziehenden erweitert. So stand sie auch ukrainischen Geflüchteten offen, die zeitgleich mit der Eröffnung des MigraDO in Dortmund ankamen.
Das Dienstleistungszentrum liegt in der Innenstadt in direkter räumlicher Nähe zu den Bürgerdiensten und der Ausländerbehörde. Von dort aus werden Zuziehende idealerweise direkt zur Erstberatung von MigraDO weitergeleitet. Die melderechtliche Anmeldung von EU-Bürger*innen findet sogar in denselben Räumlichkeiten statt. Die Anlaufstelle fungiert dabei als sog. One-Stop-Shop, in dem der spezifische Unterstützungsbedarf beim Ankommen des Haushaltes in einzelnen Lebensbereichen (z. B. Schule, Wohnen, Spracherwerb, Pflegebedarf) an einer zentralen Anlaufstelle eruiert wird. Die darauffolgende Unterstützung reicht von der qualifizierten Verweisberatung zu anderen zuständigen Stellen bis hin zum Case Management. Das Dienstleistungszentrum MigraDO zeigt zum einen, wie eine Anpassung an verändernde Zielgruppen und eine Reaktion auf Ankommensbedarfe auch über verschiedene Gruppen hinweg gelingen können. Zum anderen wurde mit dem Projekt explizit das initiale Ankommen in den Blick genommen, bei dem die melderechtliche Anmeldung als eine wichtige Stellschraube fungiert.
3.3 Willkommensnetzwerk lokal willkommen
Im Gegensatz zum One-Stop-Shop MigraDO verfolgt das Willkommensnetzwerk lokal willkommen von Anfang an einen dezentralen Ansatz. Es entstand ebenfalls im Kontext der Fluchtzuwanderung um 2015, als Geflüchtete oftmals mit Unterstützung durch Haupt- und Ehrenamtliche von der Gemeinschaftsunterkunft in eine selbst angemietete Wohnung umzogen und in unterschiedlichen Nachbarschaften Fuß fassten. In den Quartieren, wo die Menschen zusammenleben, stellen sich die Weichen für den weiteren Integrationserfolg.
Im Jahr 2015 beauftragte der Rat der Stadt die Verwaltung, ein Konzept für ein lokales Integrationsnetzwerk für Geflüchtete mit dem Ziel zu entwickeln, in allen Stadtbezirken bzw. Wohnquartieren qualitative und gleiche Startchancen für Geflüchtete zu schaffen: Dezentralität und Wohnortnähe sind Grundgedanken des Netzwerks. Gerade wenn Geflüchtete – aufgrund der Standorte von Unterbringungseinrichtungen, Wohnungsmarktentwicklungen oder anderer Faktoren – abseits von traditionellen Ankunftsquartieren unterkommen, ist es wichtig, den Zugang zu Beratungsstrukturen sicherzustellen. Lokal willkommen sollte dementsprechend als wohnortnahe Anlaufstelle Geflüchteten mit Beratungsbedarf sowie Bürger*innen und Anwohner*innen, die sich engagieren wollen oder Fragen haben, einen niederschwelligen Ort bieten, um ihre Anliegen vorzubringen.
Aus diesen Leitgedanken entwickelte sich das Pilotprojekt lokal willkommen, eine städtische Kooperation mit den Wohlfahrtsverbänden und weiteren Partner*innen, dessen erstes Standortlokal 2016 eröffnete. Bereits 2017 wurde lokal willkommen in den kommunal-finanzierten Regelbetrieb (ergänzt durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds des Bundes) überführt und von da an sukzessive auf alle Stadtbezirke ausgeweitet. Seit 2021 ist das Integrationsnetzwerk in allen Stadtteilen präsent (siehe Abb. 3). Dabei unterstützt es einerseits Geflüchtete im Rahmen der Beratung bei der Bearbeitung ihrer individuellen Bedarfe und arbeitet gleichzeitig mit Kirchengemeinden, Initiativen, Verbänden, Sportvereinen, Vermieter*innen und weiteren Akteur*innen auf lokaler Ebene eng zusammen, um einen Beitrag zur Mobilisierung und Stärkung der Gemeinwesenarbeit zu leisten (Stadt Dortmund 2021b). In den Augen der Betreibenden werden die Büros des Integrationsnetzwerks sowohl von neuzugezogenen als auch von alteingesessenen Einwohner*innen gut angenommen und dienen der Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Insbesondere der Beratungsbedarf bei neuzugezogenen Menschen zeigte sich durchgängig als sehr hoch: Von Oktober 2016 bis August 2022 wurden durch die sieben lokalen Standorte über 4.500 Haushalte mit über 13.000 Personen informiert und beraten. An den Standorten zeigt sich auch, wie Neuzugezogene dabei nach einiger Zeit selbst zu (ehrenamtlichen) Unterstützer*innen werden, die ihr Wissen weitergeben und aktiver Teil der Strukturen werden.

Abb. 3 Übersicht über Standorte der Büros des Integrationswerks lokal willkommen und deren Trägerstruktur. (Quelle: Eigene Darstellung, nach Stadt Dortmund 2021b)
Die lokal willkommen-Büros werden in Kooperation mit den Wohlfahrtsverbänden und weiteren Akteur*innen in der Geflüchtetenhilfe betrieben und sind mit angestellten Fachkräften einerseits aus der Stadtverwaltung und andererseits eines Kooperationspartners besetzt (siehe Abb. 3). Zukünftig sollen dynamische lokal willkommen-Dependancen an weiteren Standorten die vorhandenen Integrationsstrukturen und bestehenden Handlungsinstrumente kleinräumig ergänzen, verstetigen und ausbauen. Der dezentrale und kleinräumige Ansatz des Willkommensnetzwerks versucht der oft fragmentarischen Vernetzung sowie dem lückenhaften Austausch der Akteur*innen in den Quartieren entgegenzuwirken.
4 Ankommenspolitiken in den Spannungsfeldern von…
In Dortmund zeigt sich, wie Politiken des Ankommens als Teil kommunaler Integrationspolitik gezielt die Anfangszeit von Neuzugewanderten und deren initialen Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen in den Blick nehmen. Dies geschieht in Reaktion auf sich stetig verändernde Zuwanderungsdynamiken, jedoch gleichzeitig übergreifend über einzelne Gruppen von Neuzuwandernden hinweg. Diese Ankommenspolitiken entwickeln sich innerhalb einer Vielzahl an Spannungsfeldern, die im Folgenden umrissen werden.
… Ankommen und Bleiben
Ankommenspolitiken setzen dort an, wo Menschen ankommen, und reagieren auf deren Bedarfe. Ankommen stellt einen Prozess dar, der in unterschiedlichen Feldern (z. B. Zugang zu Wohnraum, Sprache etc.) zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden kann und zudem unterschiedlich konnotiert wird. Dabei ist die Phase des Ankommens im Verständnis der Dortmunder Akteur*innen aus Verwaltung und Zivilgesellschaft nicht automatisch nach maximal drei Jahren abgeschlossen, wie dies zum Teil Regelungen auf Landes- und Bundesebene implizieren. Stattdessen bestimmt sie sich durch den erfolgreichen und gesicherten Ressourcenzugang. Die Beobachtung, dass Menschen trotz prekärer Lebensverhältnisse bleiben, stellte dahingehend einen bedeutenden Wendepunkt in der Ausgestaltung der Dortmunder Ankommenspolitiken, insbesondere der Gesamtstrategie Neuzuwanderung, dar. Diese richten sich demnach darauf, die Bedarfe beim Zugang zu unterschiedlichen Ressourcen zu erkennen und zu decken, zunächst unabhängig von der individuellen Bleibeperspektive. Da auch in Ankunftsstadtteilen der Großteil der Bewohnenden langfristig dort lebt (Kurtenbach et al. 2023; Stadt Dortmund 2023c) und Fluchtzuwanderung meist nicht vorhersehbar ist, geht es für die Ausgestaltung kommunaler Sozialpolitik darum, gut ausgestattete Regelstrukturen mit großer Offenheit für unterschiedliche Bleibeperspektiven bereitzuhalten. Zukünftig ist es wichtig, neben dem Ankommen und dem initialen Ressourcenzugang auch das Bleiben im Blick zu behalten und einen langfristigen Ressourcenzugang sicherzustellen.
… Entwicklungslinien und Planung
Die Politiken des Ankommens sind historisch vor dem Hintergrund unterschiedlicher Zuwanderungsbewegungen gewachsen und folgen lokalen „Pfad[en] der Integration“ (Dymarz et al. 2018, S. 254). Gleichzeitig passen sie sich an aktuelle Bevölkerungsentwicklungen und neue Herausforderungen an. Dies ist oftmals gekennzeichnet durch ein Learning by Doing der beteiligten Organisationen, sodass zunächst verschiedene Maßnahmen und Angebote auch nebeneinander erprobt und später im Netzwerk verstetigt, angepasst und untereinander koordiniert werden. Dies geschieht durch laufenden Austausch im Rahmen des von Seiten der Stadt koordinierten Netzwerks, insbesondere durch die gleichzeitige Verankerung der Träger in den Quartieren sowie durch Evaluierungen und Monitorings (Sachstandsberichte) auf einer übergeordneten Ebene. Daraus wird die Fortschreibung des Handlungsrahmens partizipativ entwickelt. So können über bestimmte Zielgruppen und Strukturen hinweg Synergien identifiziert werden. Erfolgreiche Ankunftsstrukturen werden nach Möglichkeit verstetigt, während gleichzeitig eine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an neu ankommende Gruppen und deren Bedarfe gewährleistet bleibt. Die Abhängigkeit vieler Maßnahmen von Fördergeldern erschwert dabei eine Verstetigung. Ein Finanzierungsmix aus unterschiedlichen Fördergeldern sowie die Überführung in (zumindest zu Teilen) kommunalfinanzierte Strukturen wie bei lokal willkommen und MigraDO sollen Kontinuität gewährleisten. Das frühzeitige Erkennen der Bedarfe durch Monitoring einerseits und die Beobachtung der Lage in den Quartieren durch die Träger andererseits ermöglichen eine frühzeitige Anpassung von Maßnahmen und Angeboten sowie deren Abstimmung aufeinander.
… quartiersbezogenen und gesamtstädtischen, zentralen und dezentralen Strukturen
Ankommen in Dortmund findet in besonderem Maße im Ankunftsquartier Nordstadt statt. Dort ist es wichtig, sozialraumorientiert, alltagsnah und wohnortnah mit Ankommenspolitiken und -angeboten präsent zu sein. Gleichzeitig wird durch den gesamtstädtischen Ansatz der lokal willkommen-Standorte dezentrale Unterstützung beim Ankommen in anderen Stadtteilen gewährleistet. Dies ist insbesondere in Hinblick auf die zunehmende Entstehung neuer Ankunftsquartiere, v. a. in peripheren Lagen (El-Kayed et al. 2020; Gerten et al. 2023), von zentraler Bedeutung. Bei der Ausdifferenzierung von Ankommenswegen wird gleichzeitig aber auch zentralen und übergeordneten Angeboten eine wichtige Funktion zuteil. MigraDO fungiert in diesem Sinne sowohl im Hinblick auf die stadträumliche Lage als auch die funktionale Bedeutung im Ankommensprozess als zentrale Anlaufstelle, die bei Bedarf an dezentrale Angebote weitervermittelt. Egal ob quartiersbezogen oder gesamtstädtisch, zentral oder dezentral – für alle Ankunftsinfrastrukturen gilt: Nur wenn sie selbst – durch räumliche und sprachliche Erreichbarkeit – zugänglich sind, können sie dabei helfen, Zugänge zu wichtigen Ressourcen zu vermitteln.
… Mainstreaming und Zielgruppenspezifik
Viele Maßnahmen der Dortmunder Gesamtstrategie versuchen strukturelle Lücken in der Regelversorgung (z. B. bei der gesundheitlichen Versorgung oder bei der Kinderbetreuung) zu kompensieren. Diese Versorgungslücken treffen Neuzugewanderte oft in besonderem Maße, da zum einen der Zugang für sie aufgrund rechtlicher, sprachlicher und anderer Barrieren teils erschwert oder gar nicht möglich ist und sie daher zum anderen verstärkt auf Unterstützung angewiesen sind. Zudem sind zahlreiche Regelangebote gerade in Ankunftsstadtteilen besonders überlastet, sodass sich strukturelle Lücken hier besonders ausgeprägt zeigen. Langfristig kann nur eine Öffnung und adäquate Ausstattung der bestehenden Systeme für alle zur gleichberechtigten Teilhabe aller Bewohnenden am gesellschaftlichen Leben führen. Unterstützung beim Ankommen auch dezentral in den Regelsystemen zu verankern, ist ein Prozess, der bereits in vielen Strukturen auf individueller und organisationaler Ebene begonnen hat und im Sinne eines diversitätsorientierten institutionellen Wandels weiterverfolgt werden sollte. Er setzt zudem voraus, dass eine stärkere rechtliche Gleichstellung und damit ein gewährleisteter Zugang aller Bewohnendenden zu den jeweiligen Strukturen erfolgt. Gleichzeitig bleiben zielgruppenspezifische Angebote für besonders diskriminierte und vulnerable Gruppen oder zur Orientierung beim Ankommen ein wichtiger Bestandteil für mehr Chancengerechtigkeit, um gezielt Nachteile auszugleichen.
… formellen und informellen Akteur*innen
Dortmunder Ankommenspolitiken sind stets ein Produkt der Zusammenarbeit einer Vielzahl von Akteur*innen. Ein wichtiges Grundprinzip ist dabei die paritätische Entwicklung durch und Besetzung mit kommunalen und zivilgesellschaftlichen Vertreter*innen. Auch trägerübergreifende Kooperationen sind in Dortmund üblich. Dies setzt ein geteiltes Zielverständnis voraus, das im Handlungsrahmen abgesteckt wird. Gleichzeitig wird anerkannt, dass eine Vielzahl weiterer, oft auch nicht in Vereinen oder ähnlichen Strukturen organisierter Akteur*innen Neuzugewanderte unterstützt. Angesichts teils ausbeuterischer Strukturen verfolgt die Stadt Dortmund einen Präventionsansatz, indem sie umfassende Beratungsangebote und Anlaufstellen zur Verfügung stellt. Neben aufsuchenden Angeboten im Rahmen der Gesamtstrategie sowie dem Dienstleistungszentrum MigraDO, das durch die Verzahnung mit dem Anmeldeprozess besonders zugänglich ist, spielt hierbei der Austausch und die Kooperation in Netzwerken wie der Gesamtstrategie eine wichtige Rolle: So etablierte beispielsweise das Jobcenter spezielle Durchwahlen und direkte Ansprechpersonen für die Träger und ist gleichzeitig mit Sprechstunden in verschiedenen Einrichtungen vor Ort präsent. Neben einer besseren Erreichbarkeit von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Anlaufstellen werden damit auch kürzere Wege zwischen Behörden und Trägern etabliert. Bei der Planung und Umsetzung von Ankommenspolitiken stärker auch Menschen mit eigener Ankommenserfahrung aktiv einzubeziehen und zu qualifizieren, findet in Ansätzen bereits statt (z. B. bei lokal willkommen und bei vielen Projekten der Gesamtstrategie). Die Partizipation innerhalb konkreter Maßnahmen, aber auch bei der Entwicklung der Politiken auszubauen, wird als wichtiges zukünftiges Entwicklungsfeld gesehen.
… Kommune, Land, Bund und EU
Ankommenspolitiken richten sich wie andere integrationspolitische Fragestellungen in ihrer gesetzlichen Verankerung und Finanzierung auch nach politischen Interessen und aktuellen Debatten. Aus der Perspektive des Dortmunder Netzwerks Neuzuwanderung fehlt es an einer ebenenübergreifenden und verbindlichen „Verantwortungsgemeinschaft“ (Stadt Dortmund 2023b, S. 1) zwischen Kommune(n), Ländern und Bund. Anstelle von kommunalen Parallelsystemen und Kompensationsstrukturen – noch dazu ohne verlässliche Finanzierung – wäre eine Erweiterung und Öffnung der Regelsysteme erforderlich, deren Anpassung in zentralen Bereichen wie Bildung und Sprachkurse, Arbeitsvermittlung und Sozialleistungen sowie Gesundheit jedoch außerhalb kommunaler Kompetenzen liegt. Zusätzlich zu den Regelsystemen ist eine verlässliche Finanzierung für Beratungs- und Begleitungsstrukturen (Ankunftsinfrastrukturen) unerlässlich. Ein wichtiger ergänzender Baustein der Dortmunder Ankommenspolitik liegt dabei in der Vertretung dieser kommunalen Anliegen auf höheren Politikebenen im Handlungsfeld (z. B. in Städtenetzwerken). Auch die EU-Ebene und insbesondere ein Dialog mit den Herkunftsstaaten und -städten wird dabei in den Blick genommen.
5 Fazit
Das Ankommen neuzuwandernder Menschen zu gestalten und zu ermöglichen ist längst zur Daueraufgabe vieler Kommunen in Deutschland geworden. Am Beispiel der nordrhein-westfälischen Stadt Dortmund haben wir aufgezeigt, wie auf kommunaler Ebene aus den Zuwanderungsbewegungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte gelernt wird und dabei Politiken des Ankommens entwickelt werden, die auch über einzelne Zuwanderungsgruppen hinweg Ankommen und Teilhabe ermöglichen sollen. Anhand der Gesamtstrategie Neuzuwanderung, dem Dienstleistungszentrum Migration und Integration MigraDO und dem Willkommensnetzwerk lokal willkommen hat das Kapitel Grundzüge und Spannungsfelder der kommunalen Ankommenspolitiken behandelt. Dem zugrunde liegt ein breiteres Ankommensverständnis als regionale und nationale Verständnisse des Ankommens; es richtet sich stärker auf die vorliegenden Bedarfe der anwesenden Gruppen und zeigt dabei Förderlücken und Zugangsbarrieren bestimmter Statusgruppen auf. Die Dortmunder Ankommenspolitiken greifen diese Defizite auf und versuchen gegenzusteuern, indem sie das Ankommen gezielt in den Blick nehmen und Zugang und Teilhabe für alle ermöglichen möchten. Dies erfordert von der Kommune zum einen ein fortlaufendes Monitoring der Bevölkerungsentwicklung auf städtischer und lokaler Ebene und zum anderen eine kontinuierliche Koordination und Abstimmung geteilter Ziele und entsprechender Maßnahmen sowie des Vorgehens der Fördermittelakquise. Dabei ist durchgehend die finanzielle Unterstützung und Anerkennung durch andere Politikebenen (Land, Bund und EU) notwendig, da Regelstrukturen Neuzugewanderten teils nicht offenstehen, aber auch zielgruppenspezifische Angebote ergänzend notwendig sind.
Die Dortmunder Politiken des Ankommens sind historisch gewachsen und speisen sich aus den Erfahrungen mit unterschiedlichen Zuwanderungsdynamiken und Migrationsbewegungen. Aus unterschiedlichen Bausteinen, die in jeweils spezifischen Akteurskonstellationen und Zuständigkeiten resultieren, wurden Synergien, übergreifende Strategien und Maßnahmen entwickelt. Es konnten einige Erfolg versprechende Ankunftsstrukturen verstetigt werden, die unterschiedlichen Zielgruppen offenstehen, flexibel auf unterschiedliche neue Zuwanderungsdynamiken reagieren und anpassungsfähig an wechselnde Bedarfe sind. Damit stellen sie ein wichtiges Fundament dar, um die Daueraufgabe der Ankommenspolitiken zu bewältigen und jeweils situativ darauf reagieren zu können.
Zugleich ist der Transfer zentraler Bedarfe auf übergeordnete Politikebenen ein wichtiger Baustein der Dortmunder Ankommenspolitiken. Dies schließt ein, auf die Situation in den Kommunen aufmerksam zu machen, diese in überlokale Migrations- und Integrationspolitiken einzubetten, Fördermittel einzuwerben und für die Öffnung der Regelstrukturen einzutreten.
Die lokal willkommen-Büros werden in Kooperation mit den Wohlfahrtsverbänden und weiteren Akteur*innen in der Geflüchtetenhilfe betrieben und sind mit angestellten Fachkräften einerseits aus der Stadtverwaltung und andererseits eines Kooperationspartners besetzt (siehe Abb. 3). Zukünftig sollen dynamische lokal willkommen-Dependancen an weiteren Standorten die vorhandenen Integrationsstrukturen und bestehenden Handlungsinstrumente kleinräumig ergänzen, verstetigen und ausbauen. Der dezentrale und kleinräumige Ansatz des Willkommensnetzwerks versucht der oft fragmentarischen Vernetzung sowie dem lückenhaften Austausch der Akteur*innen in den Quartieren entgegenzuwirken.
4 Ankommenspolitiken in den Spannungsfeldern von…
In Dortmund zeigt sich, wie Politiken des Ankommens als Teil kommunaler Integrationspolitik gezielt die Anfangszeit von Neuzugewanderten und deren initialen Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen in den Blick nehmen. Dies geschieht in Reaktion auf sich stetig verändernde Zuwanderungsdynamiken, jedoch gleichzeitig übergreifend über einzelne Gruppen von Neuzuwandernden hinweg. Diese Ankommenspolitiken entwickeln sich innerhalb einer Vielzahl an Spannungsfeldern, die im Folgenden umrissen werden.
… Ankommen und Bleiben
Ankommenspolitiken setzen dort an, wo Menschen ankommen, und reagieren auf deren Bedarfe. Ankommen stellt einen Prozess dar, der in unterschiedlichen Feldern (z. B. Zugang zu Wohnraum, Sprache etc.) zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden kann und zudem unterschiedlich konnotiert wird. Dabei ist die Phase des Ankommens im Verständnis der Dortmunder Akteur*innen aus Verwaltung und Zivilgesellschaft nicht automatisch nach maximal drei Jahren abgeschlossen, wie dies zum Teil Regelungen auf Landes- und Bundesebene implizieren. Stattdessen bestimmt sie sich durch den erfolgreichen und gesicherten Ressourcenzugang. Die Beobachtung, dass Menschen trotz prekärer Lebensverhältnisse bleiben, stellte dahingehend einen bedeutenden Wendepunkt in der Ausgestaltung der Dortmunder Ankommenspolitiken, insbesondere der Gesamtstrategie Neuzuwanderung, dar. Diese richten sich demnach darauf, die Bedarfe beim Zugang zu unterschiedlichen Ressourcen zu erkennen und zu decken, zunächst unabhängig von der individuellen Bleibeperspektive. Da auch in Ankunftsstadtteilen der Großteil der Bewohnenden langfristig dort lebt (Kurtenbach et al. 2023; Stadt Dortmund 2023c) und Fluchtzuwanderung meist nicht vorhersehbar ist, geht es für die Ausgestaltung kommunaler Sozialpolitik darum, gut ausgestattete Regelstrukturen mit großer Offenheit für unterschiedliche Bleibeperspektiven bereitzuhalten. Zukünftig ist es wichtig, neben dem Ankommen und dem initialen Ressourcenzugang auch das Bleiben im Blick zu behalten und einen langfristigen Ressourcenzugang sicherzustellen.
… Entwicklungslinien und Planung
Die Politiken des Ankommens sind historisch vor dem Hintergrund unterschiedlicher Zuwanderungsbewegungen gewachsen und folgen lokalen „Pfad[en] der Integration“ (Dymarz et al. 2018, S. 254). Gleichzeitig passen sie sich an aktuelle Bevölkerungsentwicklungen und neue Herausforderungen an. Dies ist oftmals gekennzeichnet durch ein Learning by Doing der beteiligten Organisationen, sodass zunächst verschiedene Maßnahmen und Angebote auch nebeneinander erprobt und später im Netzwerk verstetigt, angepasst und untereinander koordiniert werden. Dies geschieht durch laufenden Austausch im Rahmen des von Seiten der Stadt koordinierten Netzwerks, insbesondere durch die gleichzeitige Verankerung der Träger in den Quartieren sowie durch Evaluierungen und Monitorings (Sachstandsberichte) auf einer übergeordneten Ebene. Daraus wird die Fortschreibung des Handlungsrahmens partizipativ entwickelt. So können über bestimmte Zielgruppen und Strukturen hinweg Synergien identifiziert werden. Erfolgreiche Ankunftsstrukturen werden nach Möglichkeit verstetigt, während gleichzeitig eine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an neu ankommende Gruppen und deren Bedarfe gewährleistet bleibt. Die Abhängigkeit vieler Maßnahmen von Fördergeldern erschwert dabei eine Verstetigung. Ein Finanzierungsmix aus unterschiedlichen Fördergeldern sowie die Überführung in (zumindest zu Teilen) kommunalfinanzierte Strukturen wie bei lokal willkommen und MigraDO sollen Kontinuität gewährleisten. Das frühzeitige Erkennen der Bedarfe durch Monitoring einerseits und die Beobachtung der Lage in den Quartieren durch die Träger andererseits ermöglichen eine frühzeitige Anpassung von Maßnahmen und Angeboten sowie deren Abstimmung aufeinander.
… quartiersbezogenen und gesamtstädtischen, zentralen und dezentralen Strukturen
Ankommen in Dortmund findet in besonderem Maße im Ankunftsquartier Nordstadt statt. Dort ist es wichtig, sozialraumorientiert, alltagsnah und wohnortnah mit Ankommenspolitiken und -angeboten präsent zu sein. Gleichzeitig wird durch den gesamtstädtischen Ansatz der lokal willkommen-Standorte dezentrale Unterstützung beim Ankommen in anderen Stadtteilen gewährleistet. Dies ist insbesondere in Hinblick auf die zunehmende Entstehung neuer Ankunftsquartiere, v. a. in peripheren Lagen (El-Kayed et al. 2020; Gerten et al. 2023), von zentraler Bedeutung. Bei der Ausdifferenzierung von Ankommenswegen wird gleichzeitig aber auch zentralen und übergeordneten Angeboten eine wichtige Funktion zuteil. MigraDO fungiert in diesem Sinne sowohl im Hinblick auf die stadträumliche Lage als auch die funktionale Bedeutung im Ankommensprozess als zentrale Anlaufstelle, die bei Bedarf an dezentrale Angebote weitervermittelt. Egal ob quartiersbezogen oder gesamtstädtisch, zentral oder dezentral – für alle Ankunftsinfrastrukturen gilt: Nur wenn sie selbst – durch räumliche und sprachliche Erreichbarkeit – zugänglich sind, können sie dabei helfen, Zugänge zu wichtigen Ressourcen zu vermitteln.
… Mainstreaming und Zielgruppenspezifik
Viele Maßnahmen der Dortmunder Gesamtstrategie versuchen strukturelle Lücken in der Regelversorgung (z. B. bei der gesundheitlichen Versorgung oder bei der Kinderbetreuung) zu kompensieren. Diese Versorgungslücken treffen Neuzugewanderte oft in besonderem Maße, da zum einen der Zugang für sie aufgrund rechtlicher, sprachlicher und anderer Barrieren teils erschwert oder gar nicht möglich ist und sie daher zum anderen verstärkt auf Unterstützung angewiesen sind. Zudem sind zahlreiche Regelangebote gerade in Ankunftsstadtteilen besonders überlastet, sodass sich strukturelle Lücken hier besonders ausgeprägt zeigen. Langfristig kann nur eine Öffnung und adäquate Ausstattung der bestehenden Systeme für alle zur gleichberechtigten Teilhabe aller Bewohnenden am gesellschaftlichen Leben führen. Unterstützung beim Ankommen auch dezentral in den Regelsystemen zu verankern, ist ein Prozess, der bereits in vielen Strukturen auf individueller und organisationaler Ebene begonnen hat und im Sinne eines diversitätsorientierten institutionellen Wandels weiterverfolgt werden sollte. Er setzt zudem voraus, dass eine stärkere rechtliche Gleichstellung und damit ein gewährleisteter Zugang aller Bewohnendenden zu den jeweiligen Strukturen erfolgt. Gleichzeitig bleiben zielgruppenspezifische Angebote für besonders diskriminierte und vulnerable Gruppen oder zur Orientierung beim Ankommen ein wichtiger Bestandteil für mehr Chancengerechtigkeit, um gezielt Nachteile auszugleichen.
… formellen und informellen Akteur*innen
Dortmunder Ankommenspolitiken sind stets ein Produkt der Zusammenarbeit einer Vielzahl von Akteur*innen. Ein wichtiges Grundprinzip ist dabei die paritätische Entwicklung durch und Besetzung mit kommunalen und zivilgesellschaftlichen Vertreter*innen. Auch trägerübergreifende Kooperationen sind in Dortmund üblich. Dies setzt ein geteiltes Zielverständnis voraus, das im Handlungsrahmen abgesteckt wird. Gleichzeitig wird anerkannt, dass eine Vielzahl weiterer, oft auch nicht in Vereinen oder ähnlichen Strukturen organisierter Akteur*innen Neuzugewanderte unterstützt. Angesichts teils ausbeuterischer Strukturen verfolgt die Stadt Dortmund einen Präventionsansatz, indem sie umfassende Beratungsangebote und Anlaufstellen zur Verfügung stellt. Neben aufsuchenden Angeboten im Rahmen der Gesamtstrategie sowie dem Dienstleistungszentrum MigraDO, das durch die Verzahnung mit dem Anmeldeprozess besonders zugänglich ist, spielt hierbei der Austausch und die Kooperation in Netzwerken wie der Gesamtstrategie eine wichtige Rolle: So etablierte beispielsweise das Jobcenter spezielle Durchwahlen und direkte Ansprechpersonen für die Träger und ist gleichzeitig mit Sprechstunden in verschiedenen Einrichtungen vor Ort präsent. Neben einer besseren Erreichbarkeit von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Anlaufstellen werden damit auch kürzere Wege zwischen Behörden und Trägern etabliert. Bei der Planung und Umsetzung von Ankommenspolitiken stärker auch Menschen mit eigener Ankommenserfahrung aktiv einzubeziehen und zu qualifizieren, findet in Ansätzen bereits statt (z. B. bei lokal willkommen und bei vielen Projekten der Gesamtstrategie). Die Partizipation innerhalb konkreter Maßnahmen, aber auch bei der Entwicklung der Politiken auszubauen, wird als wichtiges zukünftiges Entwicklungsfeld gesehen.
… Kommune, Land, Bund und EU
Ankommenspolitiken richten sich wie andere integrationspolitische Fragestellungen in ihrer gesetzlichen Verankerung und Finanzierung auch nach politischen Interessen und aktuellen Debatten. Aus der Perspektive des Dortmunder Netzwerks Neuzuwanderung fehlt es an einer ebenenübergreifenden und verbindlichen „Verantwortungsgemeinschaft“ (Stadt Dortmund 2023b, S. 1) zwischen Kommune(n), Ländern und Bund. Anstelle von kommunalen Parallelsystemen und Kompensationsstrukturen – noch dazu ohne verlässliche Finanzierung – wäre eine Erweiterung und Öffnung der Regelsysteme erforderlich, deren Anpassung in zentralen Bereichen wie Bildung und Sprachkurse, Arbeitsvermittlung und Sozialleistungen sowie Gesundheit jedoch außerhalb kommunaler Kompetenzen liegt. Zusätzlich zu den Regelsystemen ist eine verlässliche Finanzierung für Beratungs- und Begleitungsstrukturen (Ankunftsinfrastrukturen) unerlässlich. Ein wichtiger ergänzender Baustein der Dortmunder Ankommenspolitik liegt dabei in der Vertretung dieser kommunalen Anliegen auf höheren Politikebenen im Handlungsfeld (z. B. in Städtenetzwerken). Auch die EU-Ebene und insbesondere ein Dialog mit den Herkunftsstaaten und -städten wird dabei in den Blick genommen.
5 Fazit
Das Ankommen neuzuwandernder Menschen zu gestalten und zu ermöglichen ist längst zur Daueraufgabe vieler Kommunen in Deutschland geworden. Am Beispiel der nordrhein-westfälischen Stadt Dortmund haben wir aufgezeigt, wie auf kommunaler Ebene aus den Zuwanderungsbewegungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte gelernt wird und dabei Politiken des Ankommens entwickelt werden, die auch über einzelne Zuwanderungsgruppen hinweg Ankommen und Teilhabe ermöglichen sollen. Anhand der Gesamtstrategie Neuzuwanderung, dem Dienstleistungszentrum Migration und Integration MigraDO und dem Willkommensnetzwerk lokal willkommen hat das Kapitel Grundzüge und Spannungsfelder der kommunalen Ankommenspolitiken behandelt. Dem zugrunde liegt ein breiteres Ankommensverständnis als regionale und nationale Verständnisse des Ankommens; es richtet sich stärker auf die vorliegenden Bedarfe der anwesenden Gruppen und zeigt dabei Förderlücken und Zugangsbarrieren bestimmter Statusgruppen auf. Die Dortmunder Ankommenspolitiken greifen diese Defizite auf und versuchen gegenzusteuern, indem sie das Ankommen gezielt in den Blick nehmen und Zugang und Teilhabe für alle ermöglichen möchten. Dies erfordert von der Kommune zum einen ein fortlaufendes Monitoring der Bevölkerungsentwicklung auf städtischer und lokaler Ebene und zum anderen eine kontinuierliche Koordination und Abstimmung geteilter Ziele und entsprechender Maßnahmen sowie des Vorgehens der Fördermittelakquise. Dabei ist durchgehend die finanzielle Unterstützung und Anerkennung durch andere Politikebenen (Land, Bund und EU) notwendig, da Regelstrukturen Neuzugewanderten teils nicht offenstehen, aber auch zielgruppenspezifische Angebote ergänzend notwendig sind.
Die Dortmunder Politiken des Ankommens sind historisch gewachsen und speisen sich aus den Erfahrungen mit unterschiedlichen Zuwanderungsdynamiken und Migrationsbewegungen. Aus unterschiedlichen Bausteinen, die in jeweils spezifischen Akteurskonstellationen und Zuständigkeiten resultieren, wurden Synergien, übergreifende Strategien und Maßnahmen entwickelt. Es konnten einige Erfolg versprechende Ankunftsstrukturen verstetigt werden, die unterschiedlichen Zielgruppen offenstehen, flexibel auf unterschiedliche neue Zuwanderungsdynamiken reagieren und anpassungsfähig an wechselnde Bedarfe sind. Damit stellen sie ein wichtiges Fundament dar, um die Daueraufgabe der Ankommenspolitiken zu bewältigen und jeweils situativ darauf reagieren zu können.
Zugleich ist der Transfer zentraler Bedarfe auf übergeordnete Politikebenen ein wichtiger Baustein der Dortmunder Ankommenspolitiken. Dies schließt ein, auf die Situation in den Kommunen aufmerksam zu machen, diese in überlokale Migrations- und Integrationspolitiken einzubetten, Fördermittel einzuwerben und für die Öffnung der Regelstrukturen einzutreten.
Literatur
Bommes, Michael. 2018. Die Rolle der Kommunen in der bundesdeutschen Migrations- und Integrationspolitik. In Handbuch Lokale Integrationspolitik, Hrsg. Frank Gesemann und Roland Roth, 99–123. Wiesbaden: Springer VS.
Certa, Christiane. 2014. Für ein gelingendes Europa müssen alle ihre Verantwortung wahrnehmen. vhw Forum Wohnen und Stadtentwicklung 2:69–74.
Der Bundespräsident. 2021. Gesprächsveranstaltung zum 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. Der Bundespräsident. https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2021/09/210910-Anwerbeabkommen-D-TUR.html. Zugegriffen am 31.08.2023.
Die Bundesregierung. 2020. Nationaler Aktionsplan Integration. Bericht Phase II – Erstintegration: Ankommen erleichtern – Werte vermitteln. Anerkennung in Deutschland. https://www.anerkennung-in-deutschland.de/assets/content/Medien_Dokumente-Fachpublikum/napi-bericht-phase-ii-data.pdf. Zugegriffen am 24.10.2023.
Dymarz, Maike, Susanne Kubiak, und Mona Wallraff. 2018. Die lokale Integration von Geflüchteten im „Pfad der Integration“. Potenziale und Anforderungen in der Stadt Dortmund. In Flucht Transit Asyl. Interdisziplinäre Perspektiven auf ein europäisches Versprechen, Hrsg. Ursula Bitzegeio, Frank Decker, Sandra Fischer, und Thorsten Stolzenberg, 254–272. Bonn: Dietz.
El-Kayed, Nihad, und Leoni Keskinkılıc. 2023. Infrastructures in the context of arrival – Multidimensional patterns of resource access in an established and a new immigrant neighborhood in Germany. Geographica Helvetica 78(3): 355–367.
El-Kayed, Nihad, Matthias Bernt, Ulrike Hamann, und Madlen Pilz. 2020. Peripheral estates as arrival spaces? Conceptualising research on arrival functions of new immigrant destinations. Urban Planning 5(3): 113–114.
Felder, Maxime, Joan Stavo-Debauge, Luca Pattaroni, Marie Trossat, und Guillaume Drevon. 2020. Between hospitality and inhospitality: The janus-faced ‘Arrival Infrastructure’. Urban Planning 5(3): 55–66.
Gerten, Christian, Heike Hanhörster, Nils Hans, und Simon Liebig. 2023. How to Identify and typify arrival spaces in European cities – A methodological approach. Population, Space and Place 29(2): e2604. https://doi.org/10.1002/psp.2604.
Gesemann, Frank, Kristin Schwarze, und Alexander Seidel. 2019. Städte leben Vielfalt: Fallstudien zum sozialen Zusammenhalt. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
Hanhörster, Heike, und Susanne Wessendorf. 2020. The role of arrival areas for migrant integration and resource access. Urban Planning 5(3): 1–10.
Hans, Nils, Heike Hanhörster, Jan Polívka, und Sabine Beißwenger. 2019. Die Rolle von Ankunftsräumen für die Integration Zugewanderter. Eine kritische Diskussion des Forschungsstandes. Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning 77(5): 511–524.
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS). 2016. Gelingende Integration im Quartier. Gutachten. Im Auftrag des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Dortmund: ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung.
Kurtenbach, Sebastian, und Katrin Rosenberger. 2021. Nachbarschaft in diversitätsgeprägten Stadtteilen. Handlungsbezüge für die kommunale Integrationspolitik. FH Münster. https://www.hb.fh-muenster.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/13263/file/KurtenbachRosenberger2021NEU.pdf. Zugegriffen am 31.08.2023.
Kurtenbach, Sebastian, Helge Döring, und Adam Khalaf. 2023. Studie zu Quartieren mit niedriger und hoher residentieller Fluktuation in Dortmund. Endbericht zur Vorlage an die Stadt Dortmund. Münster: Fachhochschule Münster/GUD Institut für Gesellschaft und Digitales. (Unveröffentlichte Studie).
May, David. 2002. Konflikte und deren Ethnisierung in der Dortmunder Nordstadt. In Der Umgang mit der Stadtgesellschaft. Ist die multikulturelle Stadt gescheitert oder wird sie zum Erfolgsmodell? Hrsg. Wolf-Dietrich Bukow und Erol Yildiz, 131–144. Opladen: Leske + Budrich.
Meeus, Bruno, Bas van Heur, und Karel Arnaut. 2019. Migration and the infrastructural politics of urban arrival. In Arrival infrastructures: Migration and urban social mobilities, Hrsg. Bruno Meeus, Karel Arnaut, und Bas van Heur, 1–32. Cham: Palgrave Macmillan.
Merkel, Frank, und Johanna Smith. 2023. Gemeinsame Trägerschaft als Zukunftsmodell. Die ökumenische Anlaufstelle für EU-Zuwander/innen „Willkommen Europa“. In Sozialraumorientierung als Fachkonzept Sozialer Arbeit und Steuerungskonzept von Sozialunternehmen. Grundlagen – Umsetzungserfordernisse – Praxiserfahrungen, Hrsg. Ulrike Wössner, 245–260. Wiesbaden: Springer VS.
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI). 2019. Nordrhein-Westfälische Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030. Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. https://www.mkjfgfi.nrw/sites/default/files/documents/rz_broschuere_mkffi_191125_obeschnitt.pdf. Zugegriffen am 05.01.2024.
Stadt Dortmund. 2006. Drucksache Nr.: 04914-06. Beschlussvorschlag für eine Begriffsdefinition ‚Integration‘ und ein integrationspolitisches Leitbild für die geplante Auftaktveranstaltung Masterplan Integration. Stadt Dortmund Serviceportal. https://rathaus.dortmund.de/dosys/gremrech2.nsf/0/6E44FD1F7300B43DC12574400005F472/$FILE/VorlageDS%2304914-06.doc.pdf. Zugegriffen am 14.11.2023.
———. 2013. Handlungsrahmen Zuwanderung aus Südosteuropa. Stadt Dortmund Serviceportal. https://rathaus.dortmund.de/dosys/gremrech2.nsf/0/46B0A336DB65A70FC1257B8700375B55/$FILE/Anlagen_09889-13.pdf. Zugegriffen am 31.08.2023.
———. 2020. Dortmunder Sachstandsbericht Zuwanderung aus Südosteuropa 2020. Stadt Dortmund Serviceportal. https://rathaus.dortmund.de/dosys/gremrech.nsf/0/100F89FF91F1281DC12585BA00526420/$FILE/Anlagen_17716-20.pdf. Zugegriffen am 31.08.2023.
———. 2021a. Dortmunder Sachstandsbericht Zuwanderung aus Südosteuropa 2021. Stadt Dortmund Serviceportal. https://rathaus.dortmund.de/dosys/gremrech.nsf/0/35A74FCA4071F47FC125872800484EA1/$FILE/Anlagen_21577-21.pdf. Zugegriffen am 31.08.2023.
———. 2021b. Fünf Jahre „lokal willkommen“ Das Dortmunder Integrationsnetzwerk. Stadt Dortmund Serviceportal. https://www.dortmund.de/dortmund/projekte/rathaus/verwaltung/sozialamt/downloads/gefluechtete-in-dortmund/lokal_willkommen_jubilaeumsbroschuere.pdf. Zugegriffen am 27.11.2023.
———. 2022. Dortmunder Sachstandsbericht Zuwanderung aus Südosteuropa 2022. Stadt Dortmund Serviceportal. https://rathaus.dortmund.de/dosys/gremrech.nsf/0/3CEB658753050014C1258899003CF9AE/$FILE/Anlagen_25007-22.pdf. Zugegriffen am 31.08.2023.
———. 2023a. Dortmunder Statistik. Tabellenband 2023 Bevölkerung. Dortmund: Stadt Dortmund. https://www.dortmund.de/dortmund/projekte/rathaus/verwaltung/dortmunder-statistik/downloads/tabellenband_2023.pdf. Zugegriffen am 15.11.2023.
———. 2023b. Entwicklung Handlungsrahmen Neuzuwanderung 2021–2022. Dortmund: Stadt Dortmund. (Unveröffentlicht).
———. 2023c. Ankommen und Bleiben in Dortmund. Ergebnisse einer Studie über Quartiere mit geringer und hoher Fluktuation – Ergebniszusammenfassung. Dortmund: Stadt Dortmund.
Statistisches Bundesamt. 2023.Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland, Zugezogene, Fortgezogene und Saldo. Destatis. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wanderungen/Tabellen/wanderungen-alle.html. Zugegriffen am 31.08.2023.
Staubach, Reiner. 2014. Zuwanderung aus Südosteuropa. Diskurs, Medienresonanz und Reaktionen auf die Herausforderungen der (Neu-)Zuwanderung am Beispiel der Dortmunder Nordstadt. Informationen zur Raumentwicklung 6(2014): 539–556.
Vertovec, Steven. 2015. Diversities old and new. Migration and socio-spatial patterns in New York, Singapore and Johannesburg. London: Palgrave Macmillan.
Wessendorf, Susanne. 2020. Accessing information and resources via arrival infrastructures: Migrant newcomers in london, LSE Working Paper 57. London: London School of Economics and Political Science.
Wilson, Helen. 2022. Arrival cities and the mobility of concepts. Urban Studies 59(16): 3459–3468.
Zoerner, Birgit, und Christiane Certa. 2020. Viele Aufgaben, wenig Unterstützung: die Dortmunder Gesamtstrategie Neuzuwanderung. In Kommunale Integrationspolitik: Strukturen, Akteure, Praxiserfahrungen, Hrsg. Tillmann Löhr, 45–58. Berlin: Deutscher Verein.
Bommes, Michael. 2018. Die Rolle der Kommunen in der bundesdeutschen Migrations- und Integrationspolitik. In Handbuch Lokale Integrationspolitik, Hrsg. Frank Gesemann und Roland Roth, 99–123. Wiesbaden: Springer VS.
Certa, Christiane. 2014. Für ein gelingendes Europa müssen alle ihre Verantwortung wahrnehmen. vhw Forum Wohnen und Stadtentwicklung 2:69–74.
Der Bundespräsident. 2021. Gesprächsveranstaltung zum 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. Der Bundespräsident. https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2021/09/210910-Anwerbeabkommen-D-TUR.html. Zugegriffen am 31.08.2023.
Die Bundesregierung. 2020. Nationaler Aktionsplan Integration. Bericht Phase II – Erstintegration: Ankommen erleichtern – Werte vermitteln. Anerkennung in Deutschland. https://www.anerkennung-in-deutschland.de/assets/content/Medien_Dokumente-Fachpublikum/napi-bericht-phase-ii-data.pdf. Zugegriffen am 24.10.2023.
Dymarz, Maike, Susanne Kubiak, und Mona Wallraff. 2018. Die lokale Integration von Geflüchteten im „Pfad der Integration“. Potenziale und Anforderungen in der Stadt Dortmund. In Flucht Transit Asyl. Interdisziplinäre Perspektiven auf ein europäisches Versprechen, Hrsg. Ursula Bitzegeio, Frank Decker, Sandra Fischer, und Thorsten Stolzenberg, 254–272. Bonn: Dietz.
El-Kayed, Nihad, und Leoni Keskinkılıc. 2023. Infrastructures in the context of arrival – Multidimensional patterns of resource access in an established and a new immigrant neighborhood in Germany. Geographica Helvetica 78(3): 355–367.
El-Kayed, Nihad, Matthias Bernt, Ulrike Hamann, und Madlen Pilz. 2020. Peripheral estates as arrival spaces? Conceptualising research on arrival functions of new immigrant destinations. Urban Planning 5(3): 113–114.
Felder, Maxime, Joan Stavo-Debauge, Luca Pattaroni, Marie Trossat, und Guillaume Drevon. 2020. Between hospitality and inhospitality: The janus-faced ‘Arrival Infrastructure’. Urban Planning 5(3): 55–66.
Gerten, Christian, Heike Hanhörster, Nils Hans, und Simon Liebig. 2023. How to Identify and typify arrival spaces in European cities – A methodological approach. Population, Space and Place 29(2): e2604. https://doi.org/10.1002/psp.2604.
Gesemann, Frank, Kristin Schwarze, und Alexander Seidel. 2019. Städte leben Vielfalt: Fallstudien zum sozialen Zusammenhalt. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
Hanhörster, Heike, und Susanne Wessendorf. 2020. The role of arrival areas for migrant integration and resource access. Urban Planning 5(3): 1–10.
Hans, Nils, Heike Hanhörster, Jan Polívka, und Sabine Beißwenger. 2019. Die Rolle von Ankunftsräumen für die Integration Zugewanderter. Eine kritische Diskussion des Forschungsstandes. Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning 77(5): 511–524.
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS). 2016. Gelingende Integration im Quartier. Gutachten. Im Auftrag des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Dortmund: ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung.
Kurtenbach, Sebastian, und Katrin Rosenberger. 2021. Nachbarschaft in diversitätsgeprägten Stadtteilen. Handlungsbezüge für die kommunale Integrationspolitik. FH Münster. https://www.hb.fh-muenster.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/13263/file/KurtenbachRosenberger2021NEU.pdf. Zugegriffen am 31.08.2023.
Kurtenbach, Sebastian, Helge Döring, und Adam Khalaf. 2023. Studie zu Quartieren mit niedriger und hoher residentieller Fluktuation in Dortmund. Endbericht zur Vorlage an die Stadt Dortmund. Münster: Fachhochschule Münster/GUD Institut für Gesellschaft und Digitales. (Unveröffentlichte Studie).
May, David. 2002. Konflikte und deren Ethnisierung in der Dortmunder Nordstadt. In Der Umgang mit der Stadtgesellschaft. Ist die multikulturelle Stadt gescheitert oder wird sie zum Erfolgsmodell? Hrsg. Wolf-Dietrich Bukow und Erol Yildiz, 131–144. Opladen: Leske + Budrich.
Meeus, Bruno, Bas van Heur, und Karel Arnaut. 2019. Migration and the infrastructural politics of urban arrival. In Arrival infrastructures: Migration and urban social mobilities, Hrsg. Bruno Meeus, Karel Arnaut, und Bas van Heur, 1–32. Cham: Palgrave Macmillan.
Merkel, Frank, und Johanna Smith. 2023. Gemeinsame Trägerschaft als Zukunftsmodell. Die ökumenische Anlaufstelle für EU-Zuwander/innen „Willkommen Europa“. In Sozialraumorientierung als Fachkonzept Sozialer Arbeit und Steuerungskonzept von Sozialunternehmen. Grundlagen – Umsetzungserfordernisse – Praxiserfahrungen, Hrsg. Ulrike Wössner, 245–260. Wiesbaden: Springer VS.
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI). 2019. Nordrhein-Westfälische Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030. Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. https://www.mkjfgfi.nrw/sites/default/files/documents/rz_broschuere_mkffi_191125_obeschnitt.pdf. Zugegriffen am 05.01.2024.
Stadt Dortmund. 2006. Drucksache Nr.: 04914-06. Beschlussvorschlag für eine Begriffsdefinition ‚Integration‘ und ein integrationspolitisches Leitbild für die geplante Auftaktveranstaltung Masterplan Integration. Stadt Dortmund Serviceportal. https://rathaus.dortmund.de/dosys/gremrech2.nsf/0/6E44FD1F7300B43DC12574400005F472/$FILE/VorlageDS%2304914-06.doc.pdf. Zugegriffen am 14.11.2023.
———. 2013. Handlungsrahmen Zuwanderung aus Südosteuropa. Stadt Dortmund Serviceportal. https://rathaus.dortmund.de/dosys/gremrech2.nsf/0/46B0A336DB65A70FC1257B8700375B55/$FILE/Anlagen_09889-13.pdf. Zugegriffen am 31.08.2023.
———. 2020. Dortmunder Sachstandsbericht Zuwanderung aus Südosteuropa 2020. Stadt Dortmund Serviceportal. https://rathaus.dortmund.de/dosys/gremrech.nsf/0/100F89FF91F1281DC12585BA00526420/$FILE/Anlagen_17716-20.pdf. Zugegriffen am 31.08.2023.
———. 2021a. Dortmunder Sachstandsbericht Zuwanderung aus Südosteuropa 2021. Stadt Dortmund Serviceportal. https://rathaus.dortmund.de/dosys/gremrech.nsf/0/35A74FCA4071F47FC125872800484EA1/$FILE/Anlagen_21577-21.pdf. Zugegriffen am 31.08.2023.
———. 2021b. Fünf Jahre „lokal willkommen“ Das Dortmunder Integrationsnetzwerk. Stadt Dortmund Serviceportal. https://www.dortmund.de/dortmund/projekte/rathaus/verwaltung/sozialamt/downloads/gefluechtete-in-dortmund/lokal_willkommen_jubilaeumsbroschuere.pdf. Zugegriffen am 27.11.2023.
———. 2022. Dortmunder Sachstandsbericht Zuwanderung aus Südosteuropa 2022. Stadt Dortmund Serviceportal. https://rathaus.dortmund.de/dosys/gremrech.nsf/0/3CEB658753050014C1258899003CF9AE/$FILE/Anlagen_25007-22.pdf. Zugegriffen am 31.08.2023.
———. 2023a. Dortmunder Statistik. Tabellenband 2023 Bevölkerung. Dortmund: Stadt Dortmund. https://www.dortmund.de/dortmund/projekte/rathaus/verwaltung/dortmunder-statistik/downloads/tabellenband_2023.pdf. Zugegriffen am 15.11.2023.
———. 2023b. Entwicklung Handlungsrahmen Neuzuwanderung 2021–2022. Dortmund: Stadt Dortmund. (Unveröffentlicht).
———. 2023c. Ankommen und Bleiben in Dortmund. Ergebnisse einer Studie über Quartiere mit geringer und hoher Fluktuation – Ergebniszusammenfassung. Dortmund: Stadt Dortmund.
Statistisches Bundesamt. 2023.Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland, Zugezogene, Fortgezogene und Saldo. Destatis. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wanderungen/Tabellen/wanderungen-alle.html. Zugegriffen am 31.08.2023.
Staubach, Reiner. 2014. Zuwanderung aus Südosteuropa. Diskurs, Medienresonanz und Reaktionen auf die Herausforderungen der (Neu-)Zuwanderung am Beispiel der Dortmunder Nordstadt. Informationen zur Raumentwicklung 6(2014): 539–556.
Vertovec, Steven. 2015. Diversities old and new. Migration and socio-spatial patterns in New York, Singapore and Johannesburg. London: Palgrave Macmillan.
Wessendorf, Susanne. 2020. Accessing information and resources via arrival infrastructures: Migrant newcomers in london, LSE Working Paper 57. London: London School of Economics and Political Science.
Wilson, Helen. 2022. Arrival cities and the mobility of concepts. Urban Studies 59(16): 3459–3468.
Zoerner, Birgit, und Christiane Certa. 2020. Viele Aufgaben, wenig Unterstützung: die Dortmunder Gesamtstrategie Neuzuwanderung. In Kommunale Integrationspolitik: Strukturen, Akteure, Praxiserfahrungen, Hrsg. Tillmann Löhr, 45–58. Berlin: Deutscher Verein.